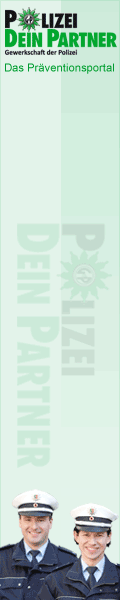Methodische Grundlagen der Tatortarbeit
Von Prof. Dr. Holger Roll, Güstrow1
1 Allgemeines
In der PDV 1002 wird der Erste Angriff, der einen Algorithmus der Vorgehensweise bei der Tatortarbeit vorgibt, beschrieben. „Beim Ersten Angriff sind neben Maßnahmen der Gefahrenabwehr
- der Tatort zu sichern und erste wesentliche Feststellungen über den Tathergang zu treffen (Sicherungsangriff) und
- der Tatbefund zu erheben (Auswertungsangriff).“

Aus dieser Definition ist erkennbar, dass ein Schwerpunkt eher einsatztaktisch zu setzen ist. Im Mittelpunkt steht die Gefahrenabwehr, was sich völlig selbstverständlich aus der Aufgabenzuweisung für die Polizei ableitet. Darüber hinaus ist der Erste Angriff aber auch von polizeiorganisatorischen Gesichtspunkten geprägt, in dem unterschieden wird bei den Zuständigkeiten im Sicherungs- (Schutzpolizei) und Auswerteangriff (Kriminalpolizei, Spezialdienststellen).3 Aus kriminalistischer Sicht liegt der Schwerpunkt des Ersten Angriffs auf dem Gebiet der Strafverfolgung, indem Beweismittel
- erkannt, gesucht und gesammelt,
- gesichert,
- ausgewertet,
- überprüft und
- beurteilt werden sollen.
Welcher Schwerpunkt im Rahmen der Tatortarbeit gesetzt wird (Gefahrenabwehr, Strafverfolgung, doppelfunktionales Handeln) gesetzt wird, ist abhängig vom konkreten Sachverhalt.
In der vorherstehenden Abbildung werden die Phasen des Ersten Angriffs den kriminalistischen Aspekten der Tatortarbeit (i.S.d. Strafverfolgung, der Beweisführung und der Wahrheitsermittlung im Strafverfahren) gegenübergestellt. Erkennbar ist, dass inhaltlich keine gravierenden Unterschiede bestehen. Lediglich organisatorische und einsatztaktische Aspekte lassen kleinere Differenzierungen zu. In den weiteren Darstellungen wird der Fokus auf die kriminalistischen Aspekte gelegt.

Abb.: Gegenüberstellung: Erster Angriff – Kriminalistische Tatortarbeit
2 Gedankliche Tätigkeit am Tatort
2.1 Analyse und Synthese
Methoden der gedanklichen Tätigkeit am Tatort sind:
- Analyse/Synthese4,
- Vergleich5,
- Versions-/Hypothesenbildung6,
- logische Methoden7.
An dieser Stelle sollen die Analyse und Synthese sowie die Versions-/Hypothesenbildung noch einmal hervorgehoben werden. Die beschriebenen Gedächtnisprozesse8 stellen eine Grundlage für das kriminalistische Denken am Tatort dar. Nur das, was wahrgenommen, eingeprägt/gespeichert wurde, kann in die Denkprozesse einbezogen werden. Die geistige Tätigkeit, „das kriminalistische Denken“, schreibt Walder9, „kennt, wenigstens als heuristisches Denken, keine Skrupel; es darf kühn sein. Solange man nur denkt, hat man noch keine Vorschriften verletzt (höchstens solche des Denkens).“ Dieser Satz sollte als Grundsatz für die Tatortanalyse/-untersuchung gelten.
Versucht man den Begriff Tatortanalyse zu definieren, so kann man darunter zwei Aspekte verstehen
- die gedankliche Tätigkeit des Ermittlungsbeamten und
- die Aufnahme des objektiven und subjektiven Tatortbefundes (als praktische Tätigkeit).
Die Besonderheit der Tatortanalyse besteht demzufolge darin, dass sie eine gedanklich-theoretische und gleichzeitig auch ein praktische Komponente i.S.d. Beweisfeststellung und -sicherung enthält.
Die gedankliche Tatortanalyse ist ein Analyse- und Syntheseverfahren10, mit dem nach kriminalistischen und kriminologischen Kriterien die vorliegenden aus der Tatortsituation ableitbaren Informationen in einem analytischen Denkprozess durchdrungen, bewertet und nach der Methode der kriminalistischen Synthese zu einem Bild über den Sachverhalt (gedankliches Modell) zusammengefügt werden. Dieses Modell ist Ausgangspunkt für durchzuführende praktische Untersuchungshandlungen, deren Ergebnisse wiederum als Grundlage für die Präzisierung, Verifizierung oder Falsifizierung des gedanklichen Modells dienen.
Die Arbeit am Tatort ist also nicht nur die bloße Aufnahme des Befundes (oder das Abarbeiten eines Ortes nach einem in einer Dienstvorschrift bestimmten Algorithmus), indem die Spuren gesucht, gesichert und fixiert und Zeugen festgestellt werden. Vielmehr wird sie durch ein überlegtes und gezieltes Vorgehen auf der Grundlage der gedanklichen Verarbeitung der Informationen, die in Versionen/Hypothesen einmünden, charakterisiert. Das Ziel dieser Tätigkeit besteht darin, eine Vorstellung vom zu untersuchenden Ereignis zu erhalten, die dem tatsächlichen Tathergang entspricht. Dieses gedankliche Modell hat hypothetischen Charakter und ist demzufolge ständig mit neuen Daten auf seine Stimmigkeit zu prüfen.
Ziele11 der gedanklichen Tätigkeit des Kriminalisten sind:
- Erfassung aller Informationen, die in be- und entlastender Hinsicht für das Ermittlungsverfahren von Bedeutung sind.
- Eine große Anzahl von Informationen schnell zu erfassen und zu speichern. Sie müssen in einer solchen Form systematisiert und klassifiziert werden, dass sie jederzeit abrufbar sind.
- Alle vorhandenen Informationen geschickt miteinander zu verknüpfen, sie zu bewerten und zu selektieren, um die kriminalistisch relevanten Informationen zu erkennen und auf ihnen die weitere kriminalistische Untersuchung zu begründen.
- Mit Versionen, gedanklichen Modellen, Hypothesen zu arbeiten. In der Kriminalistik liegen (insbesondere am Anfang der Ermittlungen) nur bruchstückhaft Informationen vor. Es ist deshalb notwendig, diese Lücken mit Versionen/Hypothesen zu überbrücken. Diese helfen, Ermittlungsansätze zu finden und geben der kriminalistischen Untersuchung eine erste Richtung.
- Informationen unterschiedlicher Qualität zu kombinieren. Das vorhandene Informationspotenzial ist dadurch gekennzeichnet, dass die Informationen als abgesicherte Erkenntnisse, als Informationen mit Wahrscheinlichkeitscharakter oder als Hypothesen vorliegen können. Eine richtige Wertung und Beurteilung der Erkenntnisse im Gesamtzusammenhang ist vorzunehmen.
Die Analyse des Tatortes und seiner räumlichen Ausdehnung ermöglicht es, im unmittelbaren Umfeld (Wahrnehmbarkeitsbereich) Zeugen und ggf. Tatverdächtige zu ermitteln. Ebenso ist es möglich, im Zusammenhang mit anderen Beweismitteln (z.B. Zeugenaussagen), den „Tatablauf zu bestimmen und damit ein solches Modell von dem Ereignis zu gewinnen, das in beweisrechtlicher Hinsicht alle wesentlichen Aspekte richtig widerspiegelt“12. Die Tatortanalyse dient dazu, Informationen zu gewinnen, die für die Überprüfung von Versionen oder anderen vorliegenden Beweismitteln (z.B. Aussagen von Zeugen oder Beschuldigten) notwendig sind. Für die Einleitung erster Maßnahmen (z.B. Fahndung, Nacheile, vorläufige Festnahme) kann der Tatort die notwendigen territorialen Anhaltspunkte geben und ist Grundlage für die kriminalistische Beurteilung der Lage.
Service
Aktivitäten
Aktuelle Ausgabe

Mit ihrem aktuellen und vielfältigen Themenspektrum, einer Mischung aus Theorie und Praxis und einem Team von renommierten Autorinnen und Autoren hat „Die Kriminalpolizei“ sich in den vergangenen Jahren einen ausgezeichneten Ruf erworben.
Erklärung einschlägiger Präventions-Begriffe
Meist gelesene Artikel
RSS Feed PolizeiDeinPartner.de
PolizeideinPartner.de - Newsfeed
-
Cannabis und Autofahren passen nicht zusammen
Test ergibt: Einschränkungen noch 20 Stunden nach dem Kiffen
-
Bilanz der Fußball-EM: Eine Spitzenleistung der Polizei
GdP-Vorsitzender Kopelke warnt vor weiteren Belastungen
-
Fake-Produkte gefährden Gesundheit und Umwelt
Mehr als ein Drittel der 15- bis 24-Jährigen in Deutschland hat schon mindestens einmal bewusst...
-
Extremismusprävention mit der „Aktion Neustart“
Wenn Extremisten sich aus ihrer Szene lösen wollen, haben sie oft einen langen und steinigen Weg...
-
Richtiges Verhalten nach einem Autodiebstahl
Es ist ein Albtraum für jeden Fahrzeugbesitzer: Wo voher noch das eigene Auto geparkt war, ist...
-
Verhaltenstipps zum Einbruchschutz
Ist niemand zuhause, wittern Einbrecher ihre Chance: Die Polizeiliche Kriminalstatistik verzeichnet...
-
Volles Verbot von Konversionsbehandlungen?
Angebote, die Menschen von ihrer Homosexualität oder ihrer selbstempfundenen geschlechtlichen...