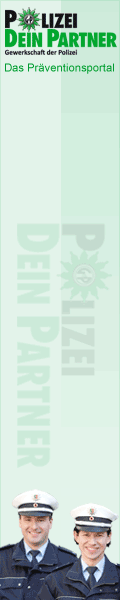Qualitätsstandards bei Lichtbildvorlagen und Identifizierungsgegenüberstellungen
Identifizierungsmaßnahmen im Sinne des § 58 Abs. 2 StPO sind als Einzel- oder Wahllichtbildvorlagen, offene oder verdeckte Einzelgegenüberstellungen oder Wahlgegenüberstellungen und akustische Gegenüberstellungen denkbar. Sie können der Begründung eines Anfangsverdachts dienen oder durchgeführt werden, um einen bestehenden Verdacht zu entkräften oder zu verstärken.

Dr. Heiko Artkämper
Staatsanwalt als
Gruppenleiter
Dortmund
Im Hinblick auf die Qualität, Verwertbarkeit und die Beweiskraft der durch sie gewonnenen Ergebnisse im Rahmen der Hauptverhandlung ist insbesondere die Unterscheidung zwischen Einzel- und Wahlidentifizierungsmaßnahmen praxisrelevant.
Abhängig von der Art der durchgeführten Identifizierungsmaßnahme ist eine richterliche Beweiswürdigung im Hinblick auf den Beweiswert der Identifizierungsmaßnahme erforderlich.
Optimale Beweisausschöpfung
Zudem sind die Strafverfolgungsbehörden gehalten, Beweismittel optimal zu Lasten und zu Gunsten des Beschuldigten auszunutzen, was etwa bei einer nicht erforderlichen Einzelidentifizierungsmaßnahme und/oder unterlassenen Wahlidentifizierungsmaßnahme möglicherweise nicht der Fall ist.
Letztlich führt hier die Wahl einer minderwertigen Identifizierungsmaßnahme zum Verlust eines besseren Beweismittels und trägt so zu ihrer eigenen relativen Unbrauchbarkeit bei.
In diesem Zusammenhang muss vor einer – in der Praxis durchaus anzutreffenden – Vorgehensweise gewarnt werden: Nur zu gerne wird ohne Not zu einer qualitativ minderwertigen Identifizierungsmaßnahme gegriffen, in der Hoffnung, dass der Zeuge dabei den Beschuldigten wiedererkennt.
Der Polizeibeamte setzt dabei darauf, dieses Wiedererkennen im Rahmen der Beschuldigtenvernehmung als „Druckmittel„ einsetzen zu können, um so zu einem Geständnis zu gelangen.
Der Weg ist falsch, da diese Taktik ein beweismäßig besseres Ergebnis der Identifizierungsmaßnahme für immer versperrt und – versagt die Taktik – den Zeugen verbrennt.
Der gewählte Versuchsaufbau einer Identifizierungsgegenüberstellung ist daher – und dessen muss sich der Polizeibeamte bewusst sein – oftmals entscheidend für den späteren Ausgang des Strafverfahrens.
Antezipierte Beweisaufnahme
Aus der Sicht der Hauptverhandlung ist allen Identifizierungsmaßnahmen gemein, dass sie einen vorweggenommenen Teil der Beweisaufnahme darstellen. Diese antezipierte Beweisaufnahme führt dazu, dass Gericht, Verteidiger und Staatsanwalt letztlich nur die Ordnungsgemäßheit des Verfahrens – die Einhaltung der anerkannten Standards durch Rekonstruktion des Procedere – überprüfen können und dann die dort erzielten Ergebnisse akzeptieren. Das Gericht muss daher in der Lage sein, im Vorfeld durch den Polizeibeamten vorgenommene Identifizierungsmaßnahmen zu rekonstruieren und diese für das Revisionsgericht nachvollziehbar im Urteil niederzulegen. Die Vorwegnahme eines Teils der Hauptverhandlung wird insbesondere dann deutlich, wenn die anerkannten Grundsätze zum wiederholten Wiedererkennen, dem praktisch kein Beweiswert zukommt, berücksichtigt werden. Eine Vermutung für die Ordnungsgemäßheit einer Identifizierungsmaßnahme im Ermittlungsverfahren besteht nicht, was zahlreiche Negativbeispiele aus der Rechtsprechung belegen.
Rechtsgrundlagen
Formfehler können sich bereits aus einer Missachtung der Anordnungskompetenz ergeben. Handelt es sich um eine Maßnahme nach § 81 a StPO, so greift der grundsätzliche Richtervorbehalt; würde die Identifizierung in Übereinstimmung mit dem BGH auf § 163 a Abs. 3 StPO gestützt, wäre eine staatsanwaltschaftliche Anordnung vonnöten. Sähe man – entgegen der Rechtsprechung – das Wiedererkennen als Maßnahme nach § 81 a StPO an, wäre es nur konsequent, mangels Gefahr im Verzug grundsätzlich einen richterlichen Beschluss zu fordern und – ist ein solcher, wie im Regelfall, nicht ergangen – die Frage der Verwertbarkeit zu problematisieren.
Eine Einordnung als staatsanwaltschaftliche Vernehmung birgt Gefahren, da die Staatsanwaltschaft die Durchführung nicht ausschließlich und originär der Polizei überlassen darf, sondern – wenn auch in den Räumen der Polizei – zumindest partiell anwesend sein muss. Zudem bestehen je nach Einordnung der Maßnahme Anwesenheitsrechte des Verteidigers, die in der Praxis nur zu gerne übersehen werden, vgl. § 163 a Abs. 3 Satz 2 i.V.m. § 168 c Abs. 1 StPO. Hieraus ein entsprechendes Verwertungsverbot in Anlehnung an die Widerspruchslösung abzuleiten, dürfte in der Rechtsprechung zwar kaum auf Gegenliebe stoßen. Allerdings scheint eine Anwendung der sogenannten Beweiswürdigungslösung bei fehlender Anwesenheit mehr als folgerichtig, da auch und gerade bei einer Identifizierungsmaßnahme ein Teil der Hauptverhandlung vorweggenommen worden ist.

Wahlidentifizierungsmaßnahmen kommt nur dann ein exponierter Beweiswert zu, wenn das präsentierte Material tatsächlich eine Wahlmöglichkeit eröffnet (Foto: Hofem)
Duldungspflichten des Beschuldigten
Der Beschuldigte muss trotz des Fehlens einer ausdrücklichen prozessualen Ermächtigungsgrundlage und des Umstandes, dass er grundsätzlich nicht verpflichtet ist, sich selbst zu belasten (nemo-tenetur-Grundsatz), Einzel- und Wahlgegenüberstellungen dulden, obwohl sie eine passive Selbstbelastung darstellen. Damit geht auch das Recht der Strafverfolgungsbehörden einher, Zwang anzuwenden. Dieser Zwang geht bis zur Herstellung eines gewissen äußeren Erscheinungsbildes durch Bekleidung und/oder Haar- und Barttracht. Zu staatsanwaltschaftlichen und richterlichen Gegenüberstellungen kann er vorgeführt werden.
Anwesenheitsrecht der Verteidigung ?
Obwohl die Rechtsprechung ein Anwesenheitsrecht der Verteidigung verneint, sollte dem Verteidiger, der seine Teilnahme wünscht, eine solche Möglichkeit eingeräumt werden: Nicht nur fair-trial und § 163 a Abs. 3 StPO (der jedenfalls unmittelbar bei staatsanwaltlichen Vernehmungen anzuwenden ist), scheinen dies zu gebieten. Darüberhinaus wird ein anwesender Verteidiger zu recht darauf achten, dass die Spielregeln und Qualitätsstandards eingehalten werden, was einem rechtsstaatlichen Verfahren zu gute kommt und spätere Einwendungen der Verteidigung gegen die Vergleichbarkeit des Materials und den Ablauf der Identifizierungsmaßnahme zwar nicht rechtlich, aber faktisch im wesentlichen präkludieren dürfte.
Die technische Ausgestaltung, der tatsächliche Ablauf und die Dokumentation der Identifizierungsmaßname ist oftmals leider nicht optimal und/oder fehlerbehaftet. Im Rahmen der Hauptverhandlung eröffnen sich dadurch Probleme, die von einem geringen Beweiswert bis hin zu einem Beweisverwertungsverbot reichen können.
Vorbereitung und Durchführung der Maßnahme
Vor der Durchführung einer Identifizierungsmaßnahme muss eine Beschreibung abgefragt worden sein, da allein diese Beschreibung zunächst die Zusammenstellung vergleichbaren Materials ermöglicht. Diese Vorbereitungsmaßnahmen sind selbstverständlich aktenkundig zu machen. In der Hauptverhandlung ist ein Wiedererkennen nur dann von Beweiswert, wenn es – etwa anhand partieller Identität von Täterbeschreibung und Erscheinungsbild des Beschuldigten – im Rahmen der Beweiswürdigung nachvollziehbar ist.
Eine Vorwegidentifikation muss in jedem Fall vermieden werden; sie kann insbesondere dadurch erfolgen, dass der Zeuge den Beschuldigten auf einem Fahndungsplakat wiedererkannt oder zufällig mit ihm – etwa in den Räumen des Polizeipräsidiums – zusammengetroffen ist und ihn dabei wahrgenommen hat.
Suggestive Instruktionen, durch die die Aufmerksamkeit des Zeugen auf eine bestimmte Person oder ein bestimmtes Bild gelenkt wird, erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer Fehlidentifizierung. Dies gilt sowohl für verbale als auch für non-verbale Beeinflussungen. Der Beamte, der die Identifizierungsmaßnahme durchführt, sollte möglichst nicht Sachbearbeiter sein, da dadurch non-verbale Suggestionen ausgeschlossen werden. Er sollte Identifizierungsschwellen aufbauen und insbesondere dem Zeugen klar machen, dass auch die Möglichkeit besteht, dass sich der Beschuldigte nicht unter dem Identifizierungsmaterial befindet. Nur der Zeuge, der nicht einem Identifizierungsdruck und Erkennenszwang ausgesetzt ist, kann sich optimal entscheiden. Ihm darf daher nicht nur – verbal oder formularmäßig – die Möglichkeit von „Nicht-Erkannt„ bis „Sicher-Erkannt„ eingeräumt werden; vielmehr muss es auch die Entscheidungsvariante „Ich weiß es nicht„ oder „Ich kann mich nicht erinnern„ geben, ohne dass dem Zeugen dadurch das Gefühl vermittelt wird, er habe versagt.
Nach neueren Untersuchungen scheint die Qualität und die Identifizierungsleistung von einer Kombination der Beurteilungsvarianten aus Entscheidungszeit und subjektiver Sicherheit abhängig zu sein: Subjektiv sichere und schnelle Zeugen, die also eher intuitiv eine Person auswählen, weisen eine höhere Trefferrate auf, als langsame und unsichere. Es sollten daher Identifizierungsprotokolle geführt werden, die die Entscheidungszeiten festhalten und in denen in einem Eindrucksvermerk auch die subjektive Überzeugung des Zeugen mit dokumentiert wird, selbst wenn diese Erkenntnisse bislang noch nicht validiert sind.
Auswahlmöglichkeiten schaffen
Wahlidentifizierungsmaßnahmen kommt nur dann ein exponierter Beweiswert zu, wenn das präsentierte Material tatsächlich eine Wahlmöglichkeit eröffnet und nicht aufgrund gravierender Abweichungen nur eine Pseudoauswahl stattfindet. Sachverhalte, die in der Vergangenheit Gegenstand der Rechtsprechung waren, zeichnen hier ein durchaus groteskes Bild, das von Abweichungen bei der Kleidung, im Alter, der Mißachtung des sogenannten Mittlereffektes und von der Hervorhebung von Bildern – etwa durch Pfeile – gekennzeichnet ist; auch unterschiedliche Bildgrößen wurden präsentiert und hatten suggestiven Charakter.
Alle Wahlidentifizierungsmaßnahmen unterliegen identischen Kriterien, die sich ansatzweise aus Nr. 18 RiStBV ergeben. Erforderlich ist daher eine Vergleichbarkeit im Hinblick auf die wesentlichen Vergleichsmerkmale. Bei diesen ist – alternativ oder kumulativ – in verstärktem Maße darauf zu achten, dass das Vergleichsmaterial eine Vergleichbarkeit eröffnet und nicht bereits gewisse Auffälligkeiten des Beschuldigten derart ausgeprägt sind, dass das Ergebnis der Wahlidentifizierungsmaßnahme auch ohne hellseherische Fähigkeiten prognostizierbar ist.
Merkmale, die keine wesentlichen Abweichungen bei dem vorgelegten Identifizierungsmaterial zulassen, sind daher
- das äußere Erscheinungsbild: Größe und Körperumfang, Haar- und Barttracht und deren Farben, Hautfarbe, Brille, besondere unveränderbare Auffälligkeiten, Körperbau,
- das Alter,
- das Geschlecht,
- die Kleidungsstücke (ideal: identische Bekleidung),
- die Vergleichbarkeit des vorgelegten Bildmaterials (insbesondere auch nach Art und Größe der Aufnahmen) und
- die Klangähnlichkeit der Stimmen (Stimmlagen/Dialekte).
Bei der Auswahl von Vergleichspersonen sollte von der Einbeziehung von Polizeibeamten abgesehen werden, da diese allein aufgrund ihres routinierten Auftretens eine andere Ausstrahlung auf den Zeugen haben, als Zivilpersonen und insbesondere ein möglicherweise verunsicherter und nervöser Beschuldigter, der seine Identifikation fürchtet.
Datenschutz
Bislang wenig Resonanz hat die Frage gefunden, ob ein denkbarer Verstoß gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen bei der Vorlage von Bildmaterial Auswirkungen auf die Verwertbarkeit des Ergebnisses tätigt. Zu denken ist daran, sofern anderweitig zweckgebunden erhobene und gespeicherte Bilder durch eine Lichtbildvorlage entgegen ihrer ursprünglichen Zweckbindung verwendet werden. Auch wenn hier ein Verstoß gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen vorliegen mag, gilt der allgemeine Grundsatz, dass aus einem Beweiserhebungsverbot nicht per se ein Beweisverwertungsverbot folgt, zumal durch die zweckwidrige Verwendung nicht die Rechte des Beschuldigten, sondern „nur„ die Rechte der abgebildeten Betroffenen tangiert wurden. Allerdings dürfte diese Problematik durch die von den Ländern eingeführten Bildvorlagesysteme und die dadurch mögliche Verwendung virtueller Personen im wesentlichen entschärft sein.
Dokumentation
Die Richtlinien für das Straf- und Bußgeldverfahren (RiStBV) begründen in Nr. 18 eine Dokumentationspflicht, die es ermöglichen soll, die Einhaltung der Standards zu überprüfen. Sie erfordert die Aufnahme des Materials in die Akte. Verweise auf polizeiliche Bilddateien sind problematisch; wenn sie ausnahmsweise Verwendung finden, muss sichergestellt sein, dass diese Dateien wirklich konstant sind, d.h. auch zur Zeit der Hauptverhandlung in ihrem Bestand mit dem übereinstimmen, was dem Zeugen im Ermittlungsverfahren vorgewiesen wurde. Der BGH hat jüngst in anderem Zusammenhang mit den Belehrungsvorschriften und der inhaltlich identischen Dokumentationspflicht der Nr. 45 RiStBV darauf hingewiesen, dass Verstöße gegen Dokumentationspflichten für die Frage der Verwertbarkeit und den Beweiswert relevant sein können.
Selbst im frühen polizeilichen Ermittlungsverfahren kann eine fehlende oder mangelhafte Dokumentation etwa im Rahmen eines Haftprüfungstermins relevant werden, da es in solchen Fällen weder dem Staatsanwalt und dem Gericht, noch dem Verteidiger möglich ist, die Frage eines dringenden Tatverdachtes, der sich im wesentlichen auf ein Wiedererkennen stützt, vernünftig zu überprüfen; hier droht im Extremfall die Aufhebung des Haftbefehls, wenn die Dokumentationspflichten missachtet wurden.
Erschreckende Fehlerquoten
Der BGH hat bereits 2001 anerkannt, dass einer sukzessiven Präsentation des Identifizierungsmaterials und damit einer sequentiellen Gegenüberstellung der relativ höchste Beweiswert zukommt. Simultane Gegenüberstellungen – und dies gilt auch für andere Wahlidentifizierungsmaßnahmen – weisen eine erschreckend hohe Fehlerquote auf, die sich bei 72 %
bewegt. Die Wahrscheinlichkeit eines fehlerhaften Wiedererkennens ist größer als eine zutreffende Identifizierung, was nicht auf bösartigen – lügenden – Zeugen, sondern schlichtweg auf Irrtümern beruht. Die polizeiliche Praxis praktiziert trotzdessen weiterhin diese Vorgehensweise bzw. situative Identifizierungsmaßnahmen und steht einer sequentiellen Gegenüberstellung eher kritisch gegenüber, auch wenn sich die Fehlerquote bei einem solchen „Versuchsaufbau„ auf 44 %
senken läßt; die einzelnen Bundesländer führen allerdings mehr und mehr sequentielle Wahlidentifizierungsmaßnahmen ein.
Nach dem heutigen Stand von Rechtsprechung und Forschung zum Wiedererkennen existiert im Hinblick auf den Beweiswert eines Wiedererkennens eine qualitative Dreiteilung der Identifizierungsmaßnahmen:
- Einzelidentifikationen,
- frontale Wahlidentifikationen und
- sequentielle Wahlidentifikationen.
Einzelidentifizierungsmaßnahmen
Einzelgegenüberstellung, Einzellichtbildvorlage und Einzelstimmprobe sind regelmäßig nicht ohne jeglichen Beweiswert; das Ergebnis einer derartigen Maßnahme ist nicht per se unverwertbar. Der nach der Auffassung des BGH allerdings wesentlich geminderte Beweiswert zwingt jedoch das Gericht dazu, sich mit diesem beeinträchtigten Beweiswert bewusst in den Urteilsgründen auseinanderzusetzen. Eine Einzelidentifizierungsmaßnahme oder eine fehlerhaft durchgeführte Wahlidentifizierungsmaßnahme – dieser Gedanke läßt sich problemlos auch auf die Fälle transferieren, in denen die Wahl-
identifizierung im Rahmen der Hauptverhandlung nicht mehr rekonstruiert werden kann – führt somit zur Notwendigkeit einer besonders intensiven Beweiswürdigung: Das Gericht muss sich mit den Möglichkeiten einer Fehlidentifizierung auseinandersetzen; allein auf dieses Erkennen kann eine Verurteilung nicht gestützt werden. Allerdings kann auch diese im Vorverfahren antizipierte Beweisaufnahme ein oder der fehlende Mosaikstein im Rahmen der richterlichen Überzeugungsbildung sein.
Frontalidentifizierung
Eine lege artis durchgeführte Wahlidentifizierungsmaßnahme, bei der etwa dem Zeugen mehrere Personen frontal präsentiert werden, hat demgegenüber einen gesteigerten Beweiswert, da dem Identifizierenden eine alternative Entscheidung ermöglicht und abverlangt wurde, und er eine Auswahl aus verschiedenen – aber vergleichbaren – Identifizierungsobjekten treffen musste. Der Zwang zur Überprüfung und Verfeinerung der Identifizierungsmerkmale versetzt ihn in die Lage, Umstände anzugeben, aufgrund derer er gerade diese bestimmte Person oder Stimme wiedererkannt hat. Der Identifizierungsvorgang wird dadurch transparenter, nachvollziehbarer und begründet trotz der bereits genannten Fehlerquoten einen – allerdings nicht zwingenden – Baustein im Rahmen richterlicher Überzeugungsbildung.
Sequentielle Identifizierung
Bei sequentiellen Identifizierungsmaßnahmen wird dem Zeugen eine ihm nicht bekannte Menge von Identifizierungsmaterial einzeln und nacheinander präsentiert und nach jeder einzelnen Begutachtung sofort eine Entscheidung abverlangt. Inhaltlich handelt es sich daher um eine Auswahlidentifizierungsmaßnahme, die nur durch ihren äußerlichen Ablauf partiell an eine Einzelidentifizierungsmaßnahme erinnert, ansonsten mit dieser keine Gemeinsamkeiten aufweist, da der Zeuge von Anfang an darauf vorbereitet wird, dass ihm eine unbekannte Vielzahl von Lichtbildern, Personen oder Stimmen vorgeführt wird.
Die Vorzüge derart sukzessiven oder sequentiellen Vorgehens liegen darin, dass dem Zeugen ein relativer Ähnlichkeitsvergleich des präsentierten Material verwehrt ist; gerade diese relative Ähnlichkeitsbetrachtung hat bekanntlich oft zu Fehlidentifizierungen geführt. Der Zeuge wird vielmehr gezwungen, das Identifizierungsmaterial isoliert wahrzunehmen, zu beurteilen und daher tatsächlich (nur) mit seinem Erinnerungsbild zu vergleichen. Den damit erhöhten Anforderungen an Konzentration und Ausdauer korrespondiert ein entscheidender Vorteil: Eine Senkung der Quote von Fehlidentifikationen aufgrund des absoluten Ähnlichkeitsvergleichs, sei es durch eine Senkung der Fehlidentifikationsrate oder – wie teilweise behauptet wird – aufgrund eines Trefferraten-Effektes im Sinne einer spürbaren Erhöhung zutreffender Identifikationen. Während simultane Identifizierungsmaßnahmen häufig nur zu einer relativen Identifizierung führen, ist das Ergebnis einer sequentiellen Wahlidentifizierungsmaßnahme die Annäherung an eine weitestgehend unbeeinflusste, fehlerfreie, absolute und damit optimale Identifizierung mit dem höchsten Beweiswert. Ob die Überlegenheit sequentieller Gegenüberstellungen auch in Ausnahmefällen der Präsentation von Zwillingen und/oder Brüdern gilt, kann hier nicht problematisiert werden.
Sequentielle Videogegenüberstellungen
Wird die Wahlidentifizierungsmaßnahme als sequentielles Video-Wiedererkennensverfahren anhand von Videoaufnahmen durchgeführt, geht damit zwar der Nachteil einher, dass dem Zeugen keine plastische und mehrdimensionale – persönliche – Wahrnehmung ermöglicht wird und daher dieses Wiedererkennen im Grundsatz weniger zuverlässig scheint. Allerdings beinhaltet eine derartige Vorgehensweise den Vorteil, dass über angelegte Videodateien umfangreiches und taugliches Vergleichsmaterial zur Verfügung steht. Dieses kann zudem durch Bildbearbeitungsprogramme so aufgearbeitet werden, dass gerade hier eine Gleichartigkeit im Hinblick auf Bildgestaltung, Bildformat, Bildschärfe und Bildinhalt zu gewährleisten ist. Darüberhinaus können auch die Reaktionen des Zeugen konserviert werden und sich daher die am Gerichtsverfahren Beteiligten einen besseren Einblick in die Situation des Wiedererkennens verschaffen. Die Aufbewahrungspflicht des § 168 Abs. 2 StPO gilt naturgemäß auch hier und ist nicht disponibel.
Reihenfolge der Präsentation und wiederholtes Wiedererkennen
Eine Sonderkonstellation liegt vor, wenn sich im Nachhinein eine sequentielle Identifizierungsmaßnahme als verkappte Einzelidentifizierungsmaßnahme darstellt. Wird dem Zeugen als erstes das Bild oder die Person präsentiert, die er dann wiedererkennt, wird zwar versucht, die Vorzüge sequentiellen Vorgehens auszunutzen, durch einen Fehler im Aufbau allerdings dieser Versuch wieder zunichte gemacht.
Wird vor einer Wahlgegenüberstellung eine (Wahl-)Lichtbildvorlage durchgeführt, so ist der Beweiswert der Wahlidentifizierungsmaßnahme, die dann erstmals zur Identifizierung führt, durch die suggestive Wirkung der Lichtbildvorlage ebenso geschmälert, wie bei der umgekehrten Konstellation, bei der der Zeuge den Beschuldigten bereits bei der Lichbildvorlage erkannt hat. Dieses Phänomen des wiederholten Wiedererkennens führt dazu, dass eine ordnungsgemäße Wiedererkennensmaßnahme praktisch nur einmal möglich ist
und hierbei aufgetretene Fehler nicht etwa durch eine Wiederholung – auch nicht im Rahmen der Beweisaufnahme – repariert werden können. Diese Erkenntnis dürfte in der psychologischen Wissenschaft unstreitig sein. Das erstmalige Erkennen beinhaltet eine Festlegung durch den Zeugen; diese vorangegangene Entscheidung führt – wiederum unbewußt – zu einer Voreingenommenheit, die einer unbefangenen, ordnungsgemäßen Identifikation entgegensteht.
Ein nochmaliges – quasi wiederholendes – Wiedererkennen spielt allerdings selbst im deutschen Gerichtsalltag eine nicht nur untergeordnete Rolle: Gerichte neigen dazu, Zeugen in der Hauptverhandlung zu befragen, ob sie den – doch recht exponierten – Angeklagten wiedererkennen, der sich allein aufgrund der Sitzordnung und der Amtstrachten nahezu an einem Pranger befindet und nur allzu gerne wiedererkannt wird. All diese Versuche einer qualitativen Verbesserung der Identifizierung verkennen aber – was der BGH längst anerkannt hat – die suggestiven Merkmale und damit den Umstand, dass einem wiederholten Wiedererkennen – unbeschadet seiner Häufigkeit – praktisch kein Beweiswert zukommen darf: Der Zeuge erkennt eine Person erneut, weil er sie vorher bereits einmal identifiziert hat, ohne dass damit dieses Ergebnis aufgewertet oder gar verifiziert wird.
Ähnliches gilt bezüglich des Vorschlags, sowohl nach einer nicht erfolgreichen als auch nach einer erfolgreichen sequentiellen Identifizierung eine nochmalige simultane Präsentation des Identifizierungsmaterials vorzunehmen.
(Keine) Besonderheiten bei einer Stimmidentifizierung
Ausserhalb moderner wissenschaftlicher – sachverständiger – Methoden einer (computergestützten) Stimmvergleichsanalyse besteht häufig die Notwendigkeit oder Möglichkeit einer subjektiven akustischen Identifizierung: Zeugen sollen durch einen Stimmenvergleich oder eine Einzelstimmprobe eine Person wiedererkennen oder ausschließen.
Auch hier findet eine rein subjektive Einschätzung statt, die – wie jeder wahrscheinlich aus einer „Fehlidentifikation„ des Gesprächpartners aus dem einen oder anderen Telefonat weiss – in besonderem Maße fehleranfällig ist: Die Identifizierung einer Stimme von Gelegenheitsbekanntschaften oder gar Unbekannten fällt – von Ausnahmefällen abgesehen – bedeutend schwerer, als ein visuelles Wiedererkennen. Ausgeschlossen wird eine Stimmidentifizierung dadurch allerdings keinesfalls.
Trotz dieser gesteigerten Unsicherheit gelten die Überlegungen zu anderen Identifizierungsmaßnahmen auch hier: Im Vorfeld sind typische – wenn möglich besondere und markante – Sprachmerkmale abzufragen, was auch laienhaft erfolgen kann. Besondere Sprach- und Stimmauffälligkeiten sind – neben Dialekten und Akzenten – insbesondere die Sprechweise (hektisch schnell bis wahrnehmbar verlangsamt), die Stimmlage (piepsig bis extrem tief), biologische Defekte (Lispeln, Hasenscharte, nasale Sprache) und andere, die Stimmqualität und Sprache beeinflussende und individualisierende Umstände (Hüsteln, gehauchte und/oder rauchartige Stimme).
Diese sind ebenso zu dokumentieren, wie der Ablauf der akustischen Gegenüberstellung. Letzterer ist auf Tonträger festzuhalten, mit der Folge, dass dieser später im Rahmen der Hauptverhandlung im Wege des Augenscheinsbeweises zum Verfahrensgegenstand gemacht werden kann.
Lediglich zwei marginale Abweichungen sollen erwähnt werden: Zum einen muss zusätzlich eine Vergleichbarkeit der Hörsituationen zwischen tatrelevantem Hören und Identifizierungsmaßnahme sichergestellt sein und die Hörfähigkeit des Zeugen überprüft werden. Zum anderen kommt hier bei einer Wahlidentifikation stets nur eine sequentielle Vorgehensweise in Betracht und wurde – lange vor der Anerkennung dieser Methode im Bereich visuellen Wiedererkennens – auch stets praktiziert.
Kombination von optischem und akustischem Wiedererkennen
In geeigneten Fällen darf die Möglichkeit einer Kombination von akustischer und visueller Identifizierung nicht außer Acht gelassen werden; hier können zwei Identifizierungstreffer, die auf unterschiedlichen sinnlichen Wahrnehmungen beruhen, zu einer gesteigerten Sicherheit beitragen. Suggestionen und Vorfestlegungen müssen allerdings auch dabei ausgeschlossen werden, mit der Folge, dass entweder die Stimmprobe vor der visuellen Gegenüberstellung unter vollständiger optischer Abschirmung durchgeführt wird. Denkbar ist auch die umgekehrte Reihenfolge, wobei allerdings Sorge dafür zu tragen ist, dass der Zeuge bei der (Wahl-)Gegenüberstellung die Stimme der Person nicht wahrnehmen kann.
(Spontane und organisierte) Situative Identifizierungsmaßnahmen
Im polizeilichen Alltagsgeschäft spielt ein Phänomen, das man als situative Gegenüberstellung bezeichnen kann, eine nicht nur untergeordnete Rolle: Gemeint sind damit Fälle, in denen eine Identifikation im Umfeld eines Beschuldigten und/oder an einem Tatort stattfinden soll. Geschieht eine Straftat an einem öffentlichen Ort (Bushaltestelle, Diskothek, Szenetreffpunkte p.p.) und gibt ein Zeuge bzw. Geschädigter an, dass der Täter sich dort (häufiger) aufhalten könnte, liegt es nahe, diesen Ort gemeinsam mit dem Zeugen aufzusuchen und dadurch zu versuchen, einen Beschuldigten zu identifizieren (spontane situative Identifikation).
Gleiches gilt bei Sachverhalten, in denen ein Anfangsverdacht gegen einen bestimmten Beschuldigten bereits besteht und dieser sich bereit erklärt, sich in seinem Umfeld oder am Tatort einer Gegenüberstellung zu stellen (organisierte situative Identifikation). Es geht also um eine Identifikation außerhalb der Räumlichkeiten der Polizei, die zunächst ihrem Grunde nach – es gibt ja nur einen Täter – eine Einzelidentifizierungsmaßnahme darzustellen scheint, sofern nicht bei einer organisierten situativen Gegenüberstellung Vergleichspersonen in die Lebenssituation integriert werden, was selten gelingen wird.
Sicherlich handelt es sich – von der vorbeschriebenen Ausnahmekonstellation abgesehen – um eine Einzelidentifizierungsmaßnahme mit einem grundsätzlich geringen Beweiswert, die noch dazu dem Zeugen unmittelbare Vergleichsmöglichkeiten eröffnet, also auch die erhöhten Fehlerquellen des relativen Ähnlichkeitsvergleichs bei einer Frontalidentifizierungsmaßnahme in sich zu bergen scheint. Trotz dessen dürfte die situative Identifizierung in ihrem Beweiswert qualitativ höher einzustufen sein: So ist der „Versuchsaufbau„ und die damit einher gehende Belastung für den Zeugen zunächst bedeutend weniger anstrengend und suggestiv als die Konfrontation auf einer Polizeidienststelle, wodurch bessere Identifikationsergebnisse zu erwarten sind. Zudem sind die neueren Untersuchungen zur Relevanz der Entscheidungsgeschwindigkeit zu berücksichtigen; diese wird regelmäßig bei situativen Identifizierungen sehr kurz sein.
Die Problematik liegt hier in einer möglichst exakten Dokumentation, zumal das Szenario eben nicht inszeniert und deshalb später kaum rekonstruierbar ist. Optimal wäre eine Videodokumentation der Durchführung der Maßnahme, die es dem Gericht ermöglicht, die Umstände des Erkennens nachzuvollziehen. Eine weniger plastische Dokumentation könnte durch die Fertigung von Fotografien geschaffen werden. Ist auch dies – aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen – nicht möglich, stehen die Beamten vor der schwierigen Aufgabe, Umfeld, Personen und andere Umstände der Maßnahme möglichst exakt, lebensnah und verständlich in Eindrucksvermerken und Einsatzberichten zu dokumentieren.
Rekonstruktion der Identifizierungsmaßnahme in der Hauptverhandlung
Der Transfer der Ergebnisse einer Identifizierungsmaßnahme in die Hauptverhandung ist grundsätzlich durch Verlesung denkbar. Die Neufassung des § 256 Abs. 1 Nr. 5 StPO läßt die Rekonstruktion der Identifizierungsmaßnahmen im Rahmen des Urkundenbeweises zu; die Identifizierung stellt zwar aufgrund der antezipierten Beweisaufnahme eine besondere Ermittlungstätigkeit dar, ohne dadurch aber gesetzliche Privilegien zu genießen. Kumulativ wäre das Identifizierungsmaterial in richterlichen Augenschein zu nehmen. Da dabei aber regelmäßig eventuell vorhandene Fehler und Suggestionen nicht aufgeklärt werden können, besteht die Gefahr, dass eine hinreichende Überprüfung nicht stattfindet. Das Gericht wird daher im Rahmen seiner Amtsaufklärungspflicht auf der Vernehmung der durchführenden Ermittlungspersonen bestehen; § 256 Abs. 1 Nr. 5 StPO steht dem nicht entgegen.

Hans Werner Dietze
Das erkennende Gericht wird so seiner bestehenden Darstellungspflicht in den Urteilsgründen gerecht werden können, die – wie das BVerfG und jüngst der BGH nochmals betont haben – die rationelle Nachvollziehbarkeit der Beweiswürdigung auch bei Identifizierungsmaßnahmen erfordert.
Service
Aktivitäten
Aktuelle Ausgabe

Mit ihrem aktuellen und vielfältigen Themenspektrum, einer Mischung aus Theorie und Praxis und einem Team von renommierten Autorinnen und Autoren hat „Die Kriminalpolizei“ sich in den vergangenen Jahren einen ausgezeichneten Ruf erworben.
Erklärung einschlägiger Präventions-Begriffe
Meist gelesene Artikel
RSS Feed PolizeiDeinPartner.de
PolizeideinPartner.de - Newsfeed
-
Cannabis und Autofahren passen nicht zusammen
Test ergibt: Einschränkungen noch 20 Stunden nach dem Kiffen
-
Bilanz der Fußball-EM: Eine Spitzenleistung der Polizei
GdP-Vorsitzender Kopelke warnt vor weiteren Belastungen
-
Fake-Produkte gefährden Gesundheit und Umwelt
Mehr als ein Drittel der 15- bis 24-Jährigen in Deutschland hat schon mindestens einmal bewusst...
-
Extremismusprävention mit der „Aktion Neustart“
Wenn Extremisten sich aus ihrer Szene lösen wollen, haben sie oft einen langen und steinigen Weg...
-
Richtiges Verhalten nach einem Autodiebstahl
Es ist ein Albtraum für jeden Fahrzeugbesitzer: Wo voher noch das eigene Auto geparkt war, ist...
-
Verhaltenstipps zum Einbruchschutz
Ist niemand zuhause, wittern Einbrecher ihre Chance: Die Polizeiliche Kriminalstatistik verzeichnet...
-
Volles Verbot von Konversionsbehandlungen?
Angebote, die Menschen von ihrer Homosexualität oder ihrer selbstempfundenen geschlechtlichen...