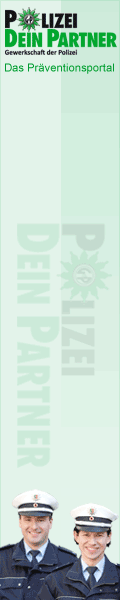Was wird gemessen, wenn „Islamfeindlichkeit“ gemessen wird?
Überdies sind bei einigen Statements Zweifel im Hinblick auf Priming-Effekte angebracht. Betrachtet man die Aussage „Durch die vielen Muslime fühle ich mich manchmal fremd im eigenen Land“, lassen sich zwei „Fallen“ identifizieren, die eine Zustimmung erleichtern – „viele“ und „manchmal“. Während das Adjektiv bereits eine Problemdiagnose vorgibt, nimmt das Adverb eine Relativierung vor und kann dazu führen, dass Befragte entsprechende – reale oder durch Medien vermittelte – Erfahrungen abrufen. Die wenig kosmopolitischen (Ost-)Deutschen, denen alltägliche Begegnungen mit Muslim/-innen eher vorenthalten blieben, könnten sich in manchen Berliner Bezirken oder in westdeutschen Metropolen durchaus wie in einem anderen Land vorkommen. In einigen deutschen Regionen gibt es Stadteile, welche in hohem Maß durch muslimische Zugewanderte und ihre Symbole geprägt sind. Nicht auszuschließen ist zudem, dass es sich bei der Item-Interpretation „um eine Fehlzuschreibung, die Forscher wie Befragte gleichermaßen vollziehen“ handelt. So sieht es zumindest Soziologieprofessor Hartmut Rosa (2015): „Es ist […] durchaus unklar, welcher der beiden Aussageteile sie dabei wirklich motiviert: dass sie sich manchmal wie Fremde im eigenen Land fühlen – oder dass daran die Muslime ‚schuld‘ sind?“. Steht den Befragten die Option „Ich stimme eher zu“ zur Verfügung, erhöht sich der Anteil „islamophober“ Antworten, wobei sich die Anzahl der eindeutigen Ablehnungen geringfügig reduziert.
Wichtig wäre auch, die Motivlage hinter der Einstellungsdimension nicht auszuklammern. Die Ablehnung einer Moschee in der Nachbarschaft muss nicht aus einer islamfeindlichen Motivation erfolgen. Neben rassistischen und/oder ausländerfeindlichen Anschauungen sind auch feministische, atheistische, religiöse oder banal-alltägliche Ursachen für die Ablehnung denkbar (vgl. Kahlweiß & Salzborn 2012: 248). Wenn Befragte mit formal hohem Bildungsabschluss einen Vorteil darin sehen, „Schulen ohne muslimische Lehrerinnen für ihre Kinder zu haben und Wohngegenden mit hohem muslimischen Bevölkerungsanteil zu vermeiden“, kann es z. B. auch an der allgemeinen Segregationsneigung liegen (Leibold & Kühnel 2006: 148). Oder auch daran, dass die Item-Formulierung „Ich würde mein Kind auch in einer Schule anmelden, in der eine moslemische Frau mit Kopftuch unterrichtet“ im Sinne eines Konfliktes mit dem Neutralitätsgebot und somit mit normativen Verfassungsgrundlagen interpretiert wird.
Mit Validität und Vergleichbarkeit sowie theoretischen Implikationen der Meinungsumfragen hängt eine weitere Problemdimension zusammen. Obwohl die meisten Studien Repräsentativität für sich beanspruchen, rufen Abweichungen ihrer Ergebnisse Fragen hervor. Vergleicht man z. B. die Ergebnisse der Sonderauswertung Islam (2015) und der „Mitte“-Studie von Zick & Klein (2014), macht die Abweichung mit Blick auf das „Fremd im eigenen Land“-Statement 8,5 Prozentpunkte aus (40 zu 31,5 Prozent), obwohl der zeitliche Abstand der Untersuchungen gering zu sein scheint. Ähnlich verhält es sich mit der Zustimmung zu der Zuwanderungsaussage: Die Abweichung beträgt 5,8 Prozentpunkte (24 zu 18,2 Prozent).
Zieht man eine weitere „Mitte“-Studie als Vergleichsgrundlage hinzu, verwirrt das gezeichnete Bild der Meinungsforscher umso mehr. Decker et al. (2014: 50) zufolge sind es gar 43 % der Befragten, die sich „wie ein Fremder im eigenen Land“ fühlen sollen, während 36,6 % Muslim/-innen die Zuwanderung nach Deutschland untersagen würden. In diesem Fall beträgt die Abweichung zu den (höheren) Messwerten des Religionsmonitors 12,6 Prozentpunkte. Nolens volens entsteht – erneut – der Verdacht, dass die Autoren nach wie vor versuchen, „jeden, der bei der Umfrage auch nur positiv gezwinkert hat, dazuzuzählen, so dass die Absicht, möglichst viele zu finden, aus dieser Methode deutlich herausscheint“ (Stützle 2010). Die Erklärung der Leipziger Forscher, warum die beiden „Mitte“-Umfragen nur eingeschränkt vergleichbar seien, bestätigt eher die Kritik der Sozialforscher: „Die Datensätze der Bielefelder Studie sind durch telefongestützte Interviews, die ‚Mitte‘-Studien der Universität Leipzig durch fragebogengestützte Face-to-face-Befragungen in den Haushalten der Befragten zustande gekommen. Aufgrund dieser unterschiedlichen Erhebungsmethoden sind sie nur eingeschränkt vergleichbar, doch ist der Anstieg so ausgeprägt, dass er nicht allein auf methodische Differenzen zurückzuführen ist“ (ebd.).
Ein weiteres Beispiel: Während laut der Studie „Die Abwertung der Anderen“ (2011) 54,1 % der deutschen Bevölkerung der Meinung waren, Muslime stellten zu viele Forderungen, fanden 85,5 % der Jugendlichen und 64,6 % der über 25-Jährigen gemäß der Studie „Deutschland postmigrantisch II“, dass es ihr gutes Recht sei, Forderungen zu stellen. Jeweils 87,2 und 74,9 % widersprachen der Aussage, Forderungen seien ein Zeichen von Undankbarkeit (Foroutan 2015: 61). Die Unterschiede im Antwortverhalten sind in diesem Fall auf die Bedeutungsinhalte der Items zurückzuführen.
Nicht minder problematisch, vor allem für die Präventionsarbeit, sind widersprüchliche Ergebnisse bzw. Interpretationen im Hinblick auf Kontakthypothese, Bildungseinflüsse, politische Selbstverortung und die Altersstruktur der „islamophoben“ Befragten. Während die Bertelsmann Stiftung eher geringe Bildungseinflüsse mit Blick auf die Bedrohungswahrnehmung und einen etwas größeren Einfluss bei der Wahrnehmung kultureller Distanz feststellte, kam die GMF-Umfrage 2007 zu dem Schluss, dass die „Islamophoben“ im Schnitt älter und schlechter gebildet waren. Das Alter soll laut Forschungen von Naika Foroutan et al. demgegenüber keinen statistisch signifikanten Einfluss haben. Eher sei der Bildungsgrad für die vorhandenen Unterschiede relevant. Nach Wilhelm Heitmeyer schütze aber Bildung kaum vor der generalisierten Abwertung der islamischen Kultur.
Ähnlich divergierend sind Angaben zum Alter der Befragten mit „islamophoben“ bzw. „islamfeindlichen“ Einstellungen. Sind z. B. gemäß „Mitte“-Studie von Zick & Klein (2014: 75) 31- bis 60-Jährige weniger belastet, sind es laut Wissenschaftlern des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung vor allem Jugendliche zwischen 16 und 25 Jahren. Hinsichtlich politischer Orientierungen lassen sich ebenfalls deutliche Interpretationsspielräume beobachten. Die politische (Selbst-)Verortung soll nach der „Mitte“-Studie ein entscheidender Faktor für die islambezogenen Bedrohungsgefühle sein, wobei Personen, die sich „links“ und „eher links“ einordneten, am wenigsten betroffen sein sollen. In den Jahren 2009/10 stieg die Islamfeindlichkeit laut GMF-Umfragen jedoch nur unter denjenigen Befragten signifikant an, die ihre Ansichten als „links“ und „Mitte“ verorteten (Küpper et al. 2013: 14).Der Religionsmonitor widerspricht: Demnach fühlen sich Befragte, die sich politisch „links“ und „(mitte)-rechts“ sehen, am stärksten durch den Islam bedroht. Übereinstimmend mit den bisherigen Beobachtungen formulierten Kahlweiß & Salzborn (2012: 249) die methodische Kritik, der zufolge „die empirischen Studien in ihrer Mehrheit nicht dazu geeignet sind, das zu messen, was konzeptionell mit dem Begriff der Islamophobie im Raum steht, sondern vielmehr allgemeine Stereotype und Vorurteile abfragen, die vor allen Dingen in einem fremdenfeindlichen und rassistischen Kontext stehen und überdies nur punktuell Aufklärungswert zu der Frage haben, ob es ein als Islamophobie zu bezeichnendes Phänomen überhaupt in nennenswerter Größenordnung gibt“. In der Tat lässt sich in vielen Fällen eine Korrelation zwischen Islam- und Fremdenfeindlichkeit beobachten. Auch die Ablehnung der Zuwanderung und Zuwandernden hängt mit negativen Einstellungen gegenüber Muslim/-innen zusammen. Aus diesem Grund hat die in vielen Umfragen gemessene „Islamophobie“ oder „Islamfeindlichkeit“ nicht immer eine spezifische Ausprägung, oder sie wäre noch präziser zu skizzieren.
Noch weniger weiß man über protektive Faktoren. Nach Küpper und Zick (2013: 16) schütz neben den – sicherlich nur positiv gearteten – direkten wie indirekten Beziehungen zur Betroffenengruppe ein gesicherter sozialer Status vor Abwertung der Minderheiten. Angesichts einer Feststellung der Autor-/innen, der zufolge die Islamfeindlichkeit „eher von Eliten“ mit Bildung und Status produziert wird sowie auch bei höheren Einkommensgruppen Verbreitung findet, erscheint die Interpretation jedoch unschlüssig.
Allem Anschein nach bringen nicht nur unterschiedliche Erhebungsmethoden nicht zu ignorierende Interpretationsunsicherheiten mit sich. Darauf deuten zumindest die hohen Werteschwankungen unabhängig von Konfidenzintervallen sowie verschiedene Korrelationseffekte hin. Über Methodenprobleme hinaus spielen die Kommunikationsregeln der Deutegemeinschaften sowie Medienberichterstattung als Moderatorvariable eine Rolle (vgl. Frindte 2013: 94ff.). Groß sind zudem Aussageunsicherheiten hinsichtlich der Variablen „Alter“, „Bildung“, „politische Selbstverortung“ usw. Somit sind Befunde der Meinungsforschung über Anstiege bzw. Verbreitung „islamfeindlicher“ Einstellungen – auch ohne Berücksichtigung spezifischer Effekte wie z. B. der Periodeneffekte – freilich cum grano salis zu genießen.
Service
Aktivitäten
Aktuelle Ausgabe

Mit ihrem aktuellen und vielfältigen Themenspektrum, einer Mischung aus Theorie und Praxis und einem Team von renommierten Autorinnen und Autoren hat „Die Kriminalpolizei“ sich in den vergangenen Jahren einen ausgezeichneten Ruf erworben.
Erklärung einschlägiger Präventions-Begriffe
Meist gelesene Artikel
RSS Feed PolizeiDeinPartner.de
PolizeideinPartner.de - Newsfeed
-
Teure Bußgelder
Verkehrsverstöße in der Schweiz werden in Deutschland vollstreckt
-
Gewalterfahrungen in der Grundschule
Wohlbefinden und Lesekompetenz von Kindern gefährdet
-
Pollensaison startet früher als sonst
Heuschnupfen hat Auswirkungen auf die Fahrtüchtigkeit
-
Polizeiliche Kriminalstatistik 2023
Gewalt-, Jugend- und Ausländerkriminalität sind gestiegen
-
Wie Betrüger Künstliche Intelligenz nutzen
Wenn uns jemand darauf aufmerksam macht, dass eine Überweisung getätigt wurde, die wir nicht...
-
Datenklau durch Scraping
Es gehört mittlerweile schon zur Normalität des Internets, dass immer wieder Fälle von...
-
Mehr Falschgeld in Deutschland
Ein Dutzend Vermögende sind 2023 in Deutschland beim Barverkauf ihrer teuren Uhren oder Autos von...