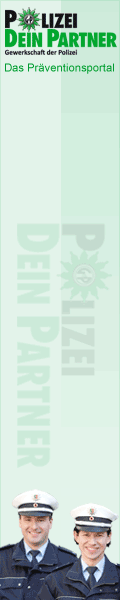Polizeiseelsorge oder vom Rendezvous mit sich
Polizeiseelsorge oder vom Rendezvous mit sich selbst, der Frage nach dem Woher und Wohin sowie den Dingen, die man nicht für möglich hielt
Von Dr. Herbert Fischer-Drumm
Polizistin oder Polizist zu sein ist etwas Besonderes. Kaum ein anderer Beruf hat solchen Einblick in die volle Bandbreite des menschlichen Lebens. „Von der Wiege bis zur Bahre” reicht der Erfahrungsschatz und die Notwendigkeit, sich oft innerhalb kürzester Zeit auf die unterschiedlichsten Situationen einstellen zu müssen. Mit Vorbereitung und Routine im Gepäck reichen jedoch diese alleine nicht aus, um die jeweilige Originalität einer Situation angemessen einschätzen zu können. Überraschungen sind an der Tagesordnung. Einerseits sind Generalisten gefordert, andererseits ist das Wissen von Spezialisten die Garantie erfolgreicher präventiver und repressiver Arbeit. Die Eigengesetzlichkeiten einer speziellen Organisationsform Polizei spielen bei der individuellen Einschätzung von Belastung und Hilfe eine ebenso wichtige Rolle. Aufgefangensein oder alleine gelassen – Nuancen persönlicher Empfindungen; hilfreich oder überflüssig – auf jeder Stufe der Hierarchie eine notwendig gestellte Frage; Organisation ihrer selbst willen oder als sinnvolles Handlungsgerüst erfahren – eine nicht unbedeutende Analyse, nicht selten konstitutiv für Motivation oder Resignation.

Dr. Herbert Fischer-Drumm,
Polizeipfarrer und
Sozialwissenschaftler
in der rheinland-pfälzischen Polizei
„Als Gott die Polizei schuf“ heißt ein Beitrag aus dem „Schaumburger Wochenblatt“. Hieraus ein ausgewählter Text: „Ein Engel kam vorbei und sagte: ‚Du beschäftigst dich aber ungewöhnlich lange mit diesem Modell.‘ Da fragte Gott zurück: ‚Hast du all die Kriterien gesehen, die das Modell erfüllen muss? Ein Polizist muss in der Lage sein, fünf Kilometer durch dunkle Gassen zu rennen, Mauern und Wände herabzuklettern, Häuser zu betreten, die der Gesundheitsminister nicht mal ansehen würde, und das alles möglichst ohne seine Uniform zu zerknittern oder zu verschmutzen. Er muss den ganzen Tag in einem zivilen Auto vor dem Haus eines Verdächtigen ausharren, gleichzeitig die Nachbarschaft nach Zeugen auskundschaften, in derselben Nacht eine Verbrechensszene untersuchen und früh am Morgen vor Gericht erscheinen und seine Aussage über eine vierzehn Monate zurückliegende Rotlichtübertretung machen.
Er muss jederzeit in Topkondition sein, und das nur mit schwarzem Kaffee und halbgegessenen Mahlzeiten. Und er braucht sechs Paar Hände.‘
Der Engel schüttelte den Kopf und sagte: ,Sechs Paar Hände... das geht nicht.‘ ‚Es sind nicht die Hände, die mir Probleme bereiten‘, sagte Gott, ‚es sind die drei Paar Augen, die ein Polizist haben muss.‘ ‚Ein ganz normaler Polizist? Warum denn das?‘, fragte der Engel.
Gott erklärte: ,Ein Augenpaar, das durch ausgebeulte Hosentaschen sehen kann, bevor er fragt, ob er sehen darf, was drin ist (obwohl er es längst weiß und dabei wünscht, er hätte einen anderen Beruf ergriffen). Ein zweites Paar Augen an der Seite des Kopfes, um die Sicherheit seines Partners in denselben zu haben. Und ein Paar vorne, das tröstlich zum Verunglückten schauen kann und ihn sagen lässt: Alles wird wieder gut, obwohl er weiß, dass es nicht so ist.‘
‚Mein Gott‘, sagte der Engel und fasste ihn am Ärmel, ‚ruhe dich doch erst mal aus, du kannst dieses Modell doch später fertig stellen.‘ ‚Das kann ich nicht‘, sagte Gott, ‚ich habe schon ein ziemlich gutes Modell geschaffen. Es kann einen 150 Kilo schweren Betrunkenen überreden, ins Polizeiauto einzusteigen, ohne dass es zu Prügeleien kommt...‘
Der Engel umkreiste den Polizisten sehr langsam und sah ihn sich genau an. Dann sagte er:
‚Kann dieses Modell auch denken?‘ ‚Aber natürlich‘, antwortete Gott, ‚es kann dir die Tatbestände von tausend Verbrechen aufzählen, Verwarnungen im Schlaf aufsagen, verhaften, untersuchen, auffinden und einen Gangster schneller von der Straße holen als Richter diskutieren, ob es berechtigt war oder nicht, während der Polizist schon den nächsten verhaftet. Und während alledem behält der Polizist noch seinen Sinn für Humor. Außerdem hat dieses Modell eine wahnsinnig gute Kontrolle über sich selbst; es ist fähig, Verbrechensszenen zu untersuchen und abzusichern, die aussehen, als wären sie der Hölle entsprungen, ohne mit der Wimper zu zu-cken. Es kann einem Kinderschänder ein Geständnis entlocken und hat trotzdem seinen aufkommenden Hass unter Kontrolle. Es kann die Familien von Opfern trösten und ihnen Mut zureden, obwohl die Zeitung immer wieder mal schreibt, Kriminelle würden nicht gerecht behandelt ...”
Sicher stellenweise überzogen, formuliert der Text doch Dichte und Aufkommen persönlicher und sachlicher Kompetenz.
Kein Beruf wie jeder andere fordert der Polizeiberuf besondere Menschen, besondere Einstellungen und Motivationen, die „in schweren Zeiten” überleben. Die uralte ethische Frage liegt in der Luft: Was mache ich eigentlich hier und warum? Sie gehört notwendigerweise ergänzt durch das Wissen um sich selbst, seine Stärken und Schwächen und deren ausgewogene Einschätzung, losgelöst auch von dem Zwang, immer nur darauf hören zu sollen, was andere sagen und schreiben. Innerhalb aller Zwänge und Hierarchien ein Stück Freiheit, für das zu kämpfen es sich lohnt.
Die Konfrontation mit der gesamten Bandbreite des Lebens, seiner Gegensätze und Widersprüchen, den Sinnlosigkeiten und Verletzungen erfordert das Rendezvous mit sich selbst. Dr. Peter Fricke spricht in solchen Zusammenhängen davon, sich einen Brief zu schreiben, einen Brief an denjenigen, der man früher war. Was erfüllte sich an Plänen, blieb auf der Strecke, fasziniert, schmerzt, macht traurig, hat überleben lassen, brachte an die Grenzen, ist es wert weiter zu machen dienstlich und privat? Nicht ganz einfach ist das Rendezvous mit sich selbst. Es geht um einen selbst, nicht die Kollegin oder den Kollegen. Sich Zeit nehmen, einen Standpunkt behalten, verteidigen.
In einer Geschichte, die im früheren Afrika spielt, wird geschildert wie eine Gruppe von Trägern unterwegs ist und zu höherem Tempo angetrieben wird. Das geht so lange bis die unter den Lasten mühsam Gehenden sich plötzlich hinsetzen.Auch Drohungen und Schläge reichen nicht aus, um sie in neuerliche Bewegung zu versetzen. Wann sie weiter gehen wollten, werden die Träger gefragt und wie lange sie noch sitzen zu bleiben die Absicht hätten. „Bis unsere Seelen nachgekommen sind”, lautet die Antwort.
„Bis unsere Seelen nachgekommen sind!” Regeln, helfen, stützen, sanktionieren, belastenden Eindrücken ausgesetzt sein bedeutet zu wissen, wo die Seele ist, in welchem Zustand sie sich befindet und wann man sich um sie im guten Sinne sorgen muss. Das Rendezvous mit sich selbst braucht Zeit, Ruhe – vor allem die Bereitschaft zum Stelldichein mit sich selbst.
Von einem Menschen ist eine Geschichte geschrieben worden, den man gefragt habe, weswegen er immer so gesammelt sein könne. Er soll geantwortet haben:
„Wenn ich stehe, dann stehe ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich esse, dann esse ich. Wenn ich spreche, dann spreche ich.”
Die Fragesteller meinten, das auch zu tun ohne den entsprechenden Erfolg. „Nein, wenn ihr sitzt, dann steht ihr schon; wenn ihr steht, dann lauft ihr schon; wenn ihr lauft, dann seid ihr schon am Ziel.“ Die Sorge um die Seelen der Polizistinnen und Polizisten hat etwas mit der „Entschleunigung der Zeit“ zu tun, damit die „Seelen nachkommen können“. Frauen und Männer in der Polizei bleiben “Menschen aus Fleisch und Blut”. Die selbst auferlegte und zugeschriebene Rolle allzeit funktionierender Wesen ohne die Seelenpflege darf nicht mit Optimierung und Maximierung in Verbindung gebracht werden – höchstens statistisch. Am Anfang und am Ende jeder Optimierung steht der Mensch. Lange schon verabschiedet haben sich ernstzunehmende Führungsmodelle von alleine den so genannten „harten Faktoren“. Soziologen, Pädagogen und Psychologen sprechen von drohender Verdinglichung und Instrumentalisierung, an deren Ende der Erfolg gemessen wird, erst in zweiter Linie nach dem gefragt wird, der für ihn verantwortlich zeichnet. Das Rendezvous mit sich selbst sichert die eigene Würde, garantiert den eigenen Standpunkt und schafft Ressourcen. Georg Christoph Lichtenberg schreibt: „Es gibt Leute, die glauben, alles wäre vernünftig, was man mit einem ernsthaften Gesicht tut.“ Johann Gottfried Herder meinte: „Der Mensch soll nicht vernünftiger, sondern menschlicher werden.“
„Das ist nicht mehr meine Polizei!“ Oft gehört und wohl auch von sich selbst ausgesprochen wurde dieser Satz. In gewissem Sinne ist es wohl auch gut, dass früher nicht heute ist. Die Möglichkeiten weiter zu kommen haben zugenommen, die Ausbildung, das Studium hat an Qualität zugenommen, der VW-Käfer wich dem Mercedes Benz, Arbeitsbedingungen und Verdienstmöglichkeiten entwickelten sich, die Zusammenarbeit mit internationalen Kollegen wurde Standard, Frauen und Männer gemeinsam in der Polizei ersetzten eine „reine Männergesellschaft“. „Panta rhei“ stammt aus dem griechischen Sprachgebrauch und meint, dass alles im Fließen begriffen ist, nichts so und dort bleibt, wo es früher einmal war. Diejenigen, die meinen, dass früher alles besser gewesen sein soll, wissen dieses Früher in sicherer Entfernung und ahnen zugleich, dass Verklärung die Folge davon ist. Reformen sind nötig, damit nicht mit den Werkzeugen der Vergangenheit die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft angegangen werden müssen. Das Ob scheint unbestritten, das Wie hingegen nicht. Modeworte sind gefunden für Reformen und Reformprozesse. Ziele werden formuliert und angegangen. Wege werden als Ziele formuliert. Führungsmodelle sind in permanenter Diskussion, Anleihen aus der „freien Wirtschaft“ werden genommen und der Name mancher Automarke fällt, geht es um Managementkonzepte in der Polizei, um Führungsverhalten, Kontrolle, Bewertung, künftige Strukturen. Ein gewisser Ehrgeiz darüber entsteht, welche Lehre die reine ist. Auch hier stimmt: Wo Bewegung ist, ist Entwicklung und wo Entwicklung ist, wird Stillstand verhindert. Polizei ist ein Teil der Gesellschaft.
Sorge um die Seelen der Beamtinnen und Beamten in der Polizei muss jede Reform – so sie wirklich eine ist – begrüßen und zugleich skeptisch beleuchten. „Cui bono?“ Diesmal stammt die Frage aus dem Lateinischen und fragt danach, wem es nützt. Der Ethiker, der Theologe muss danach fragen, ob es dem Menschen nützt, ihm alleine oder ihm und der Organisation oder nur einer Organisation in der Gestalt einer soziologischen Größe. Lehrer kommentieren die pädagogische Wirklichkeit manchmal mit „die Schule wäre schön, gäbe es nicht die Schüler“.
Reformen brauchen Zeit. Die Bewertung, ob sie sich bewährt haben oder nicht, benötigt ebenfalls Zeit, Freiräume und experimentelle Kreativität. Eine zu eilige und an einer jeweiligen politischen Prioritätensetzung orientierte Reform der Reform ist zum Scheitern verurteilt. Hektik übersieht alte Fehler und bereitet den Boden für neue. Politische Abhängigkeiten verunsichern die Organisation und die in ihr handelnden Personen. Polizeiliche Arbeit braucht Sicherheit um Sicherheit zu „produzieren“, Ruhe um gesellschaftliche Stabilität verifizieren zu helfen. Manches hochgelobte Projekt wird als Nebenschauplatz oder Hobby einzelner begeisterter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bezeichnen sein, dem Verfall preisgegeben und abhängig saisonalen Aspekten. Mit Kerngeschäft hat das nichts zu tun. Sicher, der Ethiker oder Seelsorger versteht wenig von polizeilicher Arbeit. Aber manchmal haben Universaldilettanten etwas Unbekümmertes an sich, das ansteckend wirken kann. Auf dieser Grundlage meine ich das Kerngeschäft der Polizei so bezeichnen zu sollen: Wachtmeis-ter, Schutzmann und Gendarm zu sein. Wachtmeister laufen in manche Gefahr hinein und bringen Ordnung in in Unordnung geratene Bereiche. Schutzleute halten für andere den Kopf hin, setzen sich den Hut auf. Dabei droht ihnen Gefahr für Leib und Leben. Gendarm sein, bewaffnete Frau, bewaffneter Mann und damit Wahrung und Durchsetzung des Rechts zu personifizieren, ist nichts anderes als das Gewaltmonopol des Staates buchstabiert.
Das so bezeichnete Kerngeschäft ist verantwortliche und anspruchsvolle Tätigkeit, deren Ausübung von Mensch und Organisation viel verlangt.
Von Anfang an muss der berufliche Werdegang der Polizeibeamtinnen und -beamten von einem ausgewogenen Theorie-Praxis-Verhältnis geprägt sein. Es darf nicht der Eindruck erweckt werden, dass polizeiliche Tätigkeit verwechselbar ist mit ausschließlich theoretischer Kompetenz. Soziale und ethische Kompetenz sind Teil des Erfahrungslernens und bedingen das Vorhandensein von bewussten Vorbildern.
Das ethische Selbstverständnis von Polizeibeamtinnen und -beamten muss davon geprägt sein, lebenswichtige Solidarität gegenläufig zu gesellschaftlichen Vereinzelungstendenzen zu verwirklichen. Solidarität wird jedoch dort zur Karikatur, gilt sie nur innerhalb bestimmter Hierarchien, Besoldungsgruppen oder Interessengemeinschaften.
Zu allen Zeiten haben sich Organisationen verändert, so auch aktuell die Polizei. Veränderungen sind notwendig. Sie müssen sich jedoch so ereignen, dass die Reformen mit getragen und vollzogen werden können.
Der Polizeiberuf birgt ungewöhnliche Belastungen. Nicht jede und nicht jeder ist für solche Belastungen geeignet. Bei der Auswahl muss hierauf verstärkt reagiert werden, ebenso wie auch auf die angemessene Begleitung konkreter Situationen sowie die Pflege von eigenen Ressourcen. Psychosomatische Signale dürfen nicht bagatellisiert werden. Ihr missbräuchlicher Einsatz zur Erlangung eines persönlichen Vorteils ist gerade im Hinblick auf tatsächlich betroffene Menschen diskriminierend. Führungsaufgabe bleibt dabei das schwere „Geschäft“ der Differenzierung unter Heranziehung von seriösem Sachverstand.
Der Polizeiberuf ist eine anspruchsvolle Tätigkeit und damit verbunden mit einem ungewöhnlichen Kräfteaufwand, gekoppelt an die Pflicht zu verantwortlichem Tun und Auftreten innerhalb und außerhalb der Dienstzeit. Tätigkeiten, welche einem ausgewogenen Kräfteverhältnis widersprechen oder den Beruf in der Öffentlichkeit infrage stellen, vereinbaren sich nicht. Rechtzeitig sollen Betroffene auf latente und sichtbare Konflikte angesprochen
werden.
Hierarchische Ordnungen in der Polizei dienen der Optimierung von Abläufen und Verantwortlichkeiten. Sie haben nur zweitrangig etwas mit Lokalisierung von Sachverstand auf bestimmten Ebenen zu tun. Der Hinweis auf die nächsthöhere Ebene bei der Wahrnehmung von Verantwortung entspricht nicht moderner Führungslehre, ebenso wenig die Vermutung von Kompetenz nur ab oder unterhalb eines bestimmten Dienstgrades.
Die Sorge um den Menschen in der Polizei darf nicht zu Gunsten von Strukturen und Abläufen und deren Optimierung vernachlässigt werden. Ebenso wenig darf vernachlässigt werden, dass besondere berufliche Belastungen besondere persönliche Voraussetzungen, Einstellungen und Auffassungsgaben nötig machen. In erheblichem Maße bedarf es der Pflege der Persönlichkeit im Sinne von Anspannung und Ruhe, Pflicht und Kür.
Schließlich gehören stabile Beziehungen zur Grundvoraussetzung erfolgreicher Berufsausübung. Familie und familienähnliche Strukturen, die Pflege von Freundschaften, verlässliche Partnerinnen und Partner erleichtern den Ausgleich und die Ressourcenbildung. Die Entstehung und Wirkweise von Krisen im Leben von Polizeibeamtinnen und -beamten deuten darauf hin, dass eine Übertragung in den beruflichen Alltag die Regel ist. Zur Pflege und zum Erhalt tragfähiger Beziehungen beizutragen muss ein wichtiges Ziel aller Reformen und Führungskonzepte darstellen.
Von Ludwig Börne stammt der Satz „Als Pythagoras seinen bekannten Lehrsatz entdeckte, brachte er den Göttern eine Hekatombe dar. Seitdem zittern alle Ochsen, sooft eine neue Wahrheit ans Licht kommt.“ Reformen zu diffamieren kann nicht Sinn verantwortlicher Begleitung von Menschen sein. Die Sorge um die Seelen dieser Menschen muss die Reformen danach befragen, zu welchem Zwecke sie geplant und umgesetzt werden. Ist der Mensch dabei nur Beiwerk, so sind Reformen Rückschritte. Hierzu gehört auch der Irrtum, es müsse sich alles rechnen. Manches „rechnet sich“ langfristig oder überhaupt nicht, doch bleibt dessen Bedeutung und Richtigkeit unbestritten. Eine der sinnvollsten Verschwendungen ist jene zu Guns-ten der menschlichen Zufriedenheit. Dass diese Verschwendung nicht grenzenlos sein muss, dafür sorgt die menschliche Bescheidenheit und der maßvolle Umgang mit Anspruch und Forderung. „Zuerst einmal musst du Mensch sein, erst dann kannst du Beamter sein, Arbeiter, Lehrer, Priester oder Arzt. Denn wenn dein Beruf auch wichtig, ehrlich, ja ehrwürdig ist, so darf er doch dein Menschsein nicht überwuchern. Selbst wenn die Institution, in der du arbeitest, groß, bedeutend, ja heilig ist, darfst du nicht ihr Werkzeug werden. Wenn du dich sklavisch an ihre Vorschriften hältst, zerstörst du Menschen, statt ihnen zu dienen. Keine von ihnen kann dir die Verantwortung abnehmen, als Mensch zu handeln.“ (M. Malinski)
Polizeiseelsorge ist Luxus, Luxus im polizeilichen Alltag. Luxus, dessen Inanspruchnahme sich im Grunde jede und jeder leis-ten kann: Das Gespräch nach der Hektik, die neue Perspektive nach der Ausweglosigkeit, „hierarchiefreie Kommunikation“ nach der Dienst-Besprechung, Vier-Augen-Gespräche außerhalb des Protokolls, durchatmen nach der Enge, ganz andere Gedanken im Gottesdienst, Gedanken und Worte ohne „das geht doch nicht“, Verschwiegenheit ohne Alternative, letzte Worte und
letzte Abschiede, Verständnis ohne viele Worte, Zeit von Fragen loszulassen, unprosaische Gebete, angekommen bei sich, den Menschen und Gott.
Dass so etwas möglich ist mitten in der Polizei ist Luxus. Luxus und selbstverständlich für Menschen, von denen man sagt, dass sie nach einem gewissen Ebenbild geschaffen seien.
Erinnern Sie sich an die Geschichte aus dem „Schaumburger Wochenblatt“? Ihr Ende habe ich für das Ende dieser, für eine Fachzeitschrift unüblichen Gedanken aufgehoben: „Dann sah sich der Engel das Gesicht des Polizisten genauer an, strich mit dem Finger über die Wangen des Modells und sagte: ‚Siehst du, Gott, hier ist ein Leck. Ich sagte dir doch, dass du dir zuviel vorgenommen hast bei diesem Modell.‘ ‚Das ist kein Leck‘, entgegnete Gott, ‚es ist eine Träne‘. ‚Eine Träne? Wofür?‘ wollte der Engel wissen. ‚Nun ja, für die aufgestauten Gefühle ... für die verletzten Kolleginnen und Kollegen, für die Beschimpfungen, die er hinnehmen muss, für die Undankbarkeit und die oft falschen Beschuldigungen, für die Frustration und Wut, für Einsamkeit, für Schmerz und Ohnmacht, für die schrecklichen Dinge, die er manchmal sieht. Für die Alpträume und für die Angst.“
So endet diese Geschichte mit dem Hinweis auf das, was hinter der Kleidung, der Routine und dem ersten Blick ist: Menschen, für deren Seelen jede Mühe lohnt. Aus den Schriften von Gerhart Hauptmann stammt „Jeder Mensch, richtig erkannt, ist ein bedeutender Mensch.“
(Dr. phil. Herbert Fischer-Drumm, Polizeipfarrer und Sozialwissenschaftler, Mitglied des Kriseninterventionsteams des BMI und der rheinland-pfälzischen Polizei)
Service
Aktivitäten
Aktuelle Ausgabe

Mit ihrem aktuellen und vielfältigen Themenspektrum, einer Mischung aus Theorie und Praxis und einem Team von renommierten Autorinnen und Autoren hat „Die Kriminalpolizei“ sich in den vergangenen Jahren einen ausgezeichneten Ruf erworben.
Über die angestammte Leserschaft aus Polizei, Justiz, Verwaltung und Politik hinaus wächst inzwischen die Gruppe der an Sicherheitsfragen interessierten Leserinnen und Lesern. Darüber freuen wir uns sehr. [...mehr]
Erklärung einschlägiger Präventions-Begriffe
Meist gelesene Artikel
RSS Feed PolizeiDeinPartner.de
PolizeideinPartner.de - Newsfeed
-
Cannabis und Autofahren passen nicht zusammen
Test ergibt: Einschränkungen noch 20 Stunden nach dem Kiffen
-
Bilanz der Fußball-EM: Eine Spitzenleistung der Polizei
GdP-Vorsitzender Kopelke warnt vor weiteren Belastungen
-
Fake-Produkte gefährden Gesundheit und Umwelt
Mehr als ein Drittel der 15- bis 24-Jährigen in Deutschland hat schon mindestens einmal bewusst...
-
Extremismusprävention mit der „Aktion Neustart“
Wenn Extremisten sich aus ihrer Szene lösen wollen, haben sie oft einen langen und steinigen Weg...
-
Richtiges Verhalten nach einem Autodiebstahl
Es ist ein Albtraum für jeden Fahrzeugbesitzer: Wo voher noch das eigene Auto geparkt war, ist...
-
Verhaltenstipps zum Einbruchschutz
Ist niemand zuhause, wittern Einbrecher ihre Chance: Die Polizeiliche Kriminalstatistik verzeichnet...
-
Volles Verbot von Konversionsbehandlungen?
Angebote, die Menschen von ihrer Homosexualität oder ihrer selbstempfundenen geschlechtlichen...