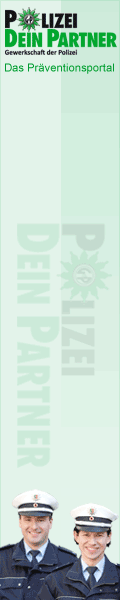My home is my castle?
-Eine Projektbeschreibung-
Von Jörg-Michael Klös, Kriminaldirektor, Berlin
Das Problem
Dieses bekannte und eingängige Sprichwort verkörpert von seiner Sinnaussage her eine Doppeldeutigkeit, die sich aber im Ergebnis durchaus ergänzen kann bzw. sollte. Mein Heim (Haus/ Wohnung) ist mein Reich, es ist der Ort, an dem ich mich wohlfühle, wo ich gerne bin, also mein Schloss. Hierhin kann ich mich zurückziehen, den Rest der Welt draußen lassen. Darüber hinaus ist mein Heim meine Burg, an diesem ganz privaten Platz ist man geborgen und sicher. Sicher vor Leuten, denen kein Zutritt gewährt werden soll, weil von ihnen Ärger oder Gefahr droht. Auf deren Anwesenheit will jeder liebend gerne verzichten. Ob unliebsame Verwandte, Vertreter oder Einbrecher, für alle ist und bleibt die Eingangstür (hoffentlich) eine unüberwindbare Grenze. Gleiches gilt für den Staat. Auch der unterwirft sich dem Grundsatz des Schutzes der Privatsphäre, der Familie, der Unverletzlichkeit der Wohnung. Die „eigenen vier Wände" dienen also als Schutz- und Trutzburg gegen ungewollte Einflüsse oder Strömungen von außen. Soweit die Theorie. Wenn dem so sein sollte, dass man sich zu Hause geborgen, wohl und sicher fühlen kann, wäre ja auch alles in Ordnung. Was aber, wenn das Schloss ein Spukschloss ist, die Heimstätte eine Folterkammer, die Burg zur Schreckensburg mutiert? Wenn im „trauten Heim" Angst, Gewalt und Unterdrückung herrscht, wenn Kinder und Frauen geschlagen, gequält, gedemütigt, eingesperrt werden? Wenn die Gefahr gar nicht von außen kommt, sondern im Rahmen struktureller Gegebenheiten zentraler
Bestandteil der engsten Lebensführung und Sozialisation ist? Muss, nein, darf der Staat, die Polizei auch dann noch eine weitgehende Zurückhaltung an den Tag legen? Viele wollen gar nicht glauben, welche Dramen und Tragödien sich zum Teil hinter einer Vielzahl von Wohnungstüren abspielen. Wollen nicht glauben, ist durchaus korrekt beschrieben, denn nicht selten ermöglicht ihnen nur ihr Wegsehen und Weghören das Schweigen. Nur nicht einmischen, keinen Ärger bekommen, nicht die Polizei oder andere Behörden informieren. Da könnte man sich ja dem Verdacht der falschen Anschuldigung aussetzen. Das Schweigen aber bereitet genau das Feld, das der Misshandler benötigt, um seine Taten ungehindert fortzusetzen.
Der Paradigmenwechsel
Die fehlende Bereitschaft der Nachbarn, der Öffentlichkeit überhaupt, sich dem Problem der Gewalt in den Familien zu öffnen und zu stellen, führte in der Vergangenheit zu fast schon grotesken Ergebnissen. Nicht der Schläger, Peiniger musste die Konsequenzen tragen, wenn eine derartige Gewaltbeziehung beendet werden sollte. Vielmehr blieb den Opfern häufig nur der Weg in die Flucht, sei es aus der Ehe oder eben aus der gemeinsamen Wohnung. Das bedeutete mitunter nichts anderes, als sich die Kinder und ein paar Sachen greifen und in ein Frauenhaus zu ziehen. Mit all den Problemen, die sich daraus für die Frau und die Kinder ergaben. Wer interessierte sich schon dafür, dass dadurch Schul- und Arbeitswege verlängert oder Freundschaften und soziale Bindungen unterbrochen wurden sowie die persönliche Zukunft unklar war? Der Täter jedenfalls hatte unter der Situation am wenigsten zu leiden. Leider hat auch die Polizei oftmals ihre Rolle und Aufgabe anläss-lich von Gewaltvorfällen in der Familie falsch verstanden. Klar, bei erheblichen Verletzungen und extremen Sachverhalten funktionierte das repressive Vorgehen in der Regel. Aber bis zu dieser Schwelle wurde eher versucht zu schlichten, zu vermitteln. Die Polizei sah sich überwiegend in der Pflicht eines Schiedsrichters, völlig verkennend, dass es eigentlich um nichts anderes ging als Strafverfolgung, also Ermittlungsarbeit, Spuren- und Beweissicherung.
Gehen wir gedanklich ein paar Jahre zurück und versetzen uns in eine solche einsatzanlassgebende Situation. Die Zentrale erteilt der Funkstreifenbesatzung den Auftrag, zu einer „Familienstreitigkeit" zu fahren. Ein Nachbar sei der Anrufer. Dieser hätte Lärm, aber auch Schreie aus der Wohnung gegenüber gehört. Na toll..., wieder mal die altbekannte Anschrift. Und wieder einmal das zigfach erlebte Szenario. Und wenn wir denn da sind, machen alle auf Eintracht. Die Frau wird uns einmal mehr erklären, dass sie sich die Verletzung im Gesicht bei einem selbst verschuldeten Sturz zugezogen hätte. Das hat mit der kleinen Meinungsverschiedenheit mit ihrem Manndie im Übrigen längst beigelegt seinicht das Geringste zu tun. Strafantrag stellen? Nein, wozu?! Da war doch nichts. Und die Kinder stehen wie immer verschüchtert, leise vor sich hinweinend in einer Ecke des Wohnzimmers. Fazit: Es ist wieder Ruhe, was dem Nachbarn am wichtigsten war. Es gibt nichts aufzuschreiben, keine Anzeige zu fertigen. Schließlich gibt es nur übereinstimmende Aussagen, dass da nichts war. Das finden die Beamten nicht falsch, denn es erspart den „Schriftkram". Die betroffene Familie ist auch froh, ist doch mal wieder alles ohne größeren Ärger abgegangen. Die Situation ist also bereinigt worden... bis zum nächsten Vorfall..., aber so ist das nun mal, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich... So oder so ähnlich spielte sich das früher ab, zu einer Zeit, als die Polizei mit derartigen Sachverhalten noch anders und eben leider nicht immer sachgerecht umgegangen ist. Auch, weil klar die Meinung vorherrschte, dass der Staat, die Polizei sich möglichst aus allen Privatbereichen heraushalten solle. Heute wäre das undenkbar. Da lernt schon jeder Berufsanfänger in den ersten Stunden der Polizeiausbildung, dass „Häusliche Gewalt" weder eine Privatangelegenheit noch ein Kavaliersdelikt ist. Heutzutage hat aber auch die Gesellschaft eine andere Einstellung. Die Problematik wird differenzierter gesehen, mit all den Negativauswirkungen (soziale Situation der Opfer, Auswirkungen auf Kinder in den Familien, Frauenhausproblematik, Kosten für Arbeitskraftausfall und für die Behandlung von Verletzungen ect.) und dem Anspruch, nunmehr auch den Ursachen für Gewaltakte in den Familien entgegenzuwirken, also den Täter in die Pflicht zu nehmen. Deshalb würde die zuvor geschilderte Situation in die Jetztzeit versetzt sicherlich damit enden, dass sehr wohl eine Strafanzeige gefertigt wird. Am Ende des Vorganges findet sich zudem der Vermerk, dass der Täter aus der gemeinsamen Wohnung weggewiesen und ein Betretungsverbot, das zugleich als Rückkehrverbot wirkt, verfügt worden ist. Die Statistik besagt, dass in Berlin im Jahr 2001 ca. 6.000 Fälle, 2002 schon 7.552 und 2003 sogar 9.623 Taten „Häusliche Gewalt" aktenkundig wurden. Dass dennoch das Dunkelfeld erheblich sein dürfte, ist nachvollziehbar. Überwiegend geht es um Gewalt seitens der Männer gegenüber Frauen, sowohl in ehelichen wie außerehelichen Lebensgemeinschaften. Täter und Opfer können auch in einem Angehörigenverhältnis zueinander stehen. Die Taten sind als ubiquitär zu bezeichnen, sie erfolgen unabhängig von sozialen Status, Bildungsstand, Alter der beteiligten Personen. Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Verbesserung des zivilgerichtlichen Schutzes bei Gewalttaten und Nachstellungen bei Trennung vom 11. Dezember 2001, kurz Gewaltschutzgesetz (GewSchG), und speziellen Regelungen zu Wegweisungsmöglichkeiten incl. Betretungs- und Rückkehrverboten in den Polizeigesetzen der Länder gilt eingriffsrechtlich nunmehr das Motto: „Wer schlägt, muss gehen". Nicht mehr die Opfer womöglich jahrelanger Misshandlungen müssen weichen, sondern die Täter oder Täterinnen haben die gemeinsame Wohnung aufgrund der einstweiligen Anordnung durch Gerichte zu verlassen. Wer einer derartigen vollstreckbaren Anordnung zuwiderhandelt, verstößt gegen §4 GewSchG, begeht also eine Straftat in Form eines Vergehenstatbestandes, welche als Offizialdelikt verfolgt wird.
Das Projekt „Häusliche Gewalt"
Im Rahmen des sechs Semester umfassenden Studiums an der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege Berlin (FHVR), in dem auch der Nachwuchs für die gehobene Laufbahn des Polizeivollzugsdienstes zum Diplomverwaltungswirt ausgebildet wird, haben die Studierenden u.a. den Nachweis über die erfolgreiche Teilnahme an einem Projekt zu erbringen. Angestrebt wird, dass sie weitgehend selbständig das Projektziel erarbeiten und zwar, soweit möglich, wissenschaftlich. Grundsätzliches zu dem bearbeiteten Thema, die Vorgehensweise zur Problemlösung und das Ergebnis werden am Schluss in einem Projektbericht zusammengefasst. Bei dem Projekt „Häusliche Gewalt" steht die Frage im Mittelpunkt, ob die Gesellschaft im Allgemeinen und die Polizei im Speziellen den Opfern bei derartigen Sachverhalten durch die zielgerichteten Maßnahmen, Reaktion und Beratungen nachhaltig helfen konnte. Haben sich die Dinge nach der Anzeigenerstattung für die Betroffenen (warum nicht eventuell auch für die Täter) positiv entwickelt und mit welchem Ergebnis? Oder hätten seinerzeit ganz andere Maßnahmen eher zu einem angestrebten Erfolg geführt? Sind die betroffenen Frauen rückblickend mit der Art des Vorgehens, mit den polizeilichen Maßnahmen, mit dem Auftreten der Polizei (und gegebenenfalls anderer Organisationen) zufrieden? Was könnten, was sollten wir anders, besser machen? Eine Reihe spannender Fragen, auf die derzeit repräsentativ noch keine Antworten vorliegen, da erst ganz wenige Interviews stattfinden konnten. Am Ende des nächsten Semesters werden wir (hoffentlich) klüger sein. Lassen wir aber zunächst die Teilnehmer zu Wort kommen: Als Studenten und Studentinnen der Fachhochschule, Fachbereich 3 (Polizeivollzugsdienst), haben wir uns im Rahmen einer Projektarbeit mit dem Thema „Häusliche Gewalt" beschäftigt und wollen neben einer intensiven Aufarbeitung der Thematik auch denkbare Schwachstellen bei der polizeilichen Bearbeitung solcher Fälle ergründen, um diese künftig zu vermeiden. Es soll den Betroffenen somit erleichtert werden den ersten und oft entscheidenden „Schritt in die Problemlösung" zu gehen. Wir haben uns zu diesem Zweck im Wintersemester 2002/2003 unter der Leitung von KD Jörg-Michael Klös zusammengefunden, um dieses Phänomen zu untersuchen. Zunächst haben wir uns mit dem Begriff „Häusliche Gewalt" auseinandergesetzt, mit seiner Stellung in der Gesellschaft früher und heute sowie daraus folgend auch die rechtliche Entwicklung der Maßnahmen durch die Polizei und die Staatsanwaltschaft, Formen der Gewalt und welche Organisationen sich damit befassen. Zentraler Bestandteil unserer Arbeit ist das Führen von Interviews mit betroffenen Opfern. Hierfür erstellten wir eigens einen Fragenkatalog, der durch Auswertung möglichst viele Hinweise darauf geben soll, wie vonseiten der Polizei mit dem/ der Betroffenen verfahren wurde, ob und in welcher Weise ihnen Hilfe auch durch andere Organisationen zuteil geworden ist und wie diese Maßnahmen von den Opfern empfunden wurden. Die Fragen, ob die Verfahrensschritte der Polizei als angemessen, hilfreich, zumutbar, sachgerecht und situationsangepasst gewertet werden und ob das Maßnahmenbündel oder Einzelaspekte (ggf. welche?) entscheidenden Anteil daran hatten, dass sich die Situation für die Opfer nachhaltig verbessert hat, interessierten insbesondere. Um einen gesicherten Aussagewert zu erlangen, wurde darauf geachtet, dass zwischen dem anlassgebenden Ereignis (Tat) und dem Interview eine deutliche Zeitspanne (mehrere Monate) lag. Die folgenden Ausführungen stellen einen Überblick über die bisherige Arbeit unserer Projektgruppe dar und sollen die Hauptaspekte „Häuslicher Gewalt" aufzeigen und problematisieren.
Die Interviews
Im Rahmen unseres Projektes werden Befragungen mit betroffenen Frauen primär mit dem Ziel durchgeführt, herauszufinden, ob die Opfer von Häuslicher Gewalt mit der Arbeit der Polizei zufrieden waren, wenn sie deren Hilfe in Anspruch genommen haben oder ihnen die Hilfe unaufgefordert zuteil wurde. Einige der Befragungen haben bereits stattgefunden, wobei unterschiedliche Aussagen gemacht wurden. Eine Geschädigte, die selbst die Polizei gerufen hatte, nachdem der Partner sie mehrfach bedrohte und schließlich vor ihrem Haus randalierte, war mit dem Polizeieinsatz sehr zufrieden. Sie sagt, die Polizisten hätten sie ernst genommen, seien sofort mit ihr zum Abschnitt gefahren, hätten sie über rechtliche Schritte aufgeklärt und den Sachverhalt ordnungsgemäß aufgenommen. Alles verlief schnell und reibungslos. Die Hilfe war dauerhaft. Die Frau hat seitdem keinen Kontakt mehr zum Täter. Bei einem anderen befragten Opfer Häuslicher Gewalt war der Auslöser für die Gewalt Eifersucht und Angst ihres damaligen Partners vor einer möglichen Trennung. Als die Situation so eskalierte, dass ihr Partner die Badezimmertür eintrat und die Befragte mit einem Messer bedrohte, rief deren ebenfalls anwesende Schwester die Polizei. Die Betroffene sagte über den Polizeieinsatz aus, dass er im Großen und Ganzen geeignet war, um die Gefahr abzuwehren, auch wenn alles recht hektisch verlief. Sie wurde aber ausreichend über alles Wichtige informiert. Was ihr nicht gefiel, waren die behördlichen Folgen des Einsatzes. Sie hatte ihren damaligen Partner in einem Gespräch dazu gebracht, seine Fehler einzusehen. Zwar trennte sie sich von ihm, aber sie ist seitdem gut mit ihm befreundet und hat keine Probleme mehr mit dem Mann. Jedoch hat sie seit dem Einsatz viele „Rennereien", weil sie aufgrund der Tatsache, dass Fälle der Häuslichen Gewalt inzwischen eine Angelegenheit sind, bei der automatisch eine Anzeige gemacht wird, ihrem damaligen Partner die Anzeige nicht ersparen konnte, so wie sie es gewollt hätte, auch um sich und den Kindern den ganzen behördlichen Vorgang zu ersparen. Weiterhin vermisst die Befragte eine entsprechende Nachsorge, zum Beispiel durch eine soziale Einrichtung. Es kümmere sich niemand darum, wie sie mit der Situation nach dem Einsatz klarkomme, auch mit der psychischen Belastung, vor Gericht aussagen zu müssen. In diesem Zusammenhang fehlte ihr auch ein entsprechender Hinweis der eingesetzten Polizeibeamten auf andere Institutionen, an die sie sich hätte wenden können. Im Allgemeinen war die Betroffene aber mit dem Einsatz selbst zum größten Teil zufrieden, da ihr in der konkreten Situation geholfen wurde. Nur die danach automatisch einsetzende „Maschinerie" gefiel ihr nicht. Zur Verdeutlichung unserer Projektarbeit nachstehend auszugsweise Beispiele aus dem von uns erstellten Fragenkatalog, der aber nicht schematisch und auch nicht schriftlich „abgearbeitet" wird. Vielmehr betten wir die Fragen ein in das jeweils geführte Gespräch, zu dem wir uns mit den Opfern verabreden. Dabei sind wir völlig offen dafür, wo das Gespräch stattfinden soll. Das entscheidet allein die Betroffene, die sich für das Interview zur Verfügung stellt. Auch sei darauf hinzuweisen, dass wir bei der Durchführung hilfreiche Unterstützung und Anwesenheit erfahrener Mitarbeiter des Stabsbereichs 4 der Direktion 6, vorrangig der Präventionsbeauftragten und / oder der Beauftragten für „Häusliche Gewalt" erhielten.
 Wer hat in Ihrem Fall die Polizei verständigt?
Wer hat in Ihrem Fall die Polizei verständigt?  Wurde Ihnen von den Beamten geholfen und wenn ja, in welcher Form?
Wurde Ihnen von den Beamten geholfen und wenn ja, in welcher Form?  War die Hilfe dauerhaft?
War die Hilfe dauerhaft?  Waren Sie damit zufrieden oder hätten Sie sich mehr/anderes versprochen?
Waren Sie damit zufrieden oder hätten Sie sich mehr/anderes versprochen?  Bitte nennen Sie Dinge, die beim Eintreffen gut funktioniert haben!
Bitte nennen Sie Dinge, die beim Eintreffen gut funktioniert haben!  Was hätte besser sein können?
Was hätte besser sein können?  Waren Ihrer Meinung nach die Maßnahmen sinnvoll?
Waren Ihrer Meinung nach die Maßnahmen sinnvoll?  Wurden Sie über rechtliche Schritte informiert?
Wurden Sie über rechtliche Schritte informiert?  Konnten Ihnen Ängste im Verfahrensverlauf genommen werden?
Konnten Ihnen Ängste im Verfahrensverlauf genommen werden?  Waren in Ihrem Fall auch Kinder betroffen? Wenn ja: Wie wurde von Seiten der Polizei damit umgegangen?
Waren in Ihrem Fall auch Kinder betroffen? Wenn ja: Wie wurde von Seiten der Polizei damit umgegangen?  Welche Institutionen haben Ihnen im Sinne der betroffenen Kinder geholfen und wie wurde geholfen?
Welche Institutionen haben Ihnen im Sinne der betroffenen Kinder geholfen und wie wurde geholfen? Was könnten/sollten andere Institutionen hierzu in Zukunft anders/besser machen?
Was könnten/sollten andere Institutionen hierzu in Zukunft anders/besser machen?  Was würden Sie anderen Betroffenen zum Umgang mit dem Thema „Gewalt in der Familie" raten?
Was würden Sie anderen Betroffenen zum Umgang mit dem Thema „Gewalt in der Familie" raten?  Was würden Sie persönlich heute im Umgang mit dem Thema „Gewalt in der Familie" anders machen?
Was würden Sie persönlich heute im Umgang mit dem Thema „Gewalt in der Familie" anders machen? Wie wünschen Sie sich einen idealtypischen Polizeieinsatz in diesem Bereich?
Wie wünschen Sie sich einen idealtypischen Polizeieinsatz in diesem Bereich?  Gibt es über die gestellten Fragen hinaus Dinge, die Sie uns zu dem Thema noch mitteilen möchten?
Gibt es über die gestellten Fragen hinaus Dinge, die Sie uns zu dem Thema noch mitteilen möchten?Wie sinnvoll oder auch überraschend eine Opferbefragung sein kann, verdeutlicht folgendes Beispiel: „Insgesamt", so eine Betroffene während des Interviews, „war das alles schon in Ordnung, wie die Polizei das damals gemacht hat." Nur eines wurde mit Nachdruck bemängelt, nämlich dass sie zum Sachverhalt sofort vernommen worden sei. Dazu habe sie seinerzeit jedoch „keinen Sender gehabt", sie sei eigentlich überhaupt nicht in der Lage gewesen, ihre Gefühle in den Griff zu bekommen und die Vernehmung emotional durchzustehen. Auf die Frage, ob sie denn lieber am nächsten Tag oder noch später hätte aussagen wollen, wurde sie nachdenklich. „Nein", antwortete sie nach längerem Zögern, „ich glaube rückblickend, dass ich dann gar nicht mehr zur Vernehmung gekommen wäre, etwas zu sagen. Außerdem war es doch wohl ganz gut, dass ich auch meine Ängste, den Frust und die Verzweiflung mit in die Vernehmung eingebracht habe." In diesem Falle hatte die nochmalige zeitversetzte Kontaktaufnahme mit der Geschädigten also zwei positive Aspekte: Sie ergab, dass die Polizei mit ihrem Vorgehen richtig lag und führte dazu, dass das Opfer eine monatelang negativ gesehene polizeiliche Maßnahme nunmehr aus eigener Erkenntnis befürwortet. Ein erster Teilerfolg unseres Projektes.
Service
Aktivitäten
Aktuelle Ausgabe

Mit ihrem aktuellen und vielfältigen Themenspektrum, einer Mischung aus Theorie und Praxis und einem Team von renommierten Autorinnen und Autoren hat „Die Kriminalpolizei“ sich in den vergangenen Jahren einen ausgezeichneten Ruf erworben.
Über die angestammte Leserschaft aus Polizei, Justiz, Verwaltung und Politik hinaus wächst inzwischen die Gruppe der an Sicherheitsfragen interessierten Leserinnen und Lesern. Darüber freuen wir uns sehr. [...mehr]
Erklärung einschlägiger Präventions-Begriffe
Meist gelesene Artikel
RSS Feed PolizeiDeinPartner.de
PolizeideinPartner.de - Newsfeed
-
Cannabis und Autofahren passen nicht zusammen
Test ergibt: Einschränkungen noch 20 Stunden nach dem Kiffen
-
Bilanz der Fußball-EM: Eine Spitzenleistung der Polizei
GdP-Vorsitzender Kopelke warnt vor weiteren Belastungen
-
Fake-Produkte gefährden Gesundheit und Umwelt
Mehr als ein Drittel der 15- bis 24-Jährigen in Deutschland hat schon mindestens einmal bewusst...
-
Extremismusprävention mit der „Aktion Neustart“
Wenn Extremisten sich aus ihrer Szene lösen wollen, haben sie oft einen langen und steinigen Weg...
-
Richtiges Verhalten nach einem Autodiebstahl
Es ist ein Albtraum für jeden Fahrzeugbesitzer: Wo voher noch das eigene Auto geparkt war, ist...
-
Verhaltenstipps zum Einbruchschutz
Ist niemand zuhause, wittern Einbrecher ihre Chance: Die Polizeiliche Kriminalstatistik verzeichnet...
-
Volles Verbot von Konversionsbehandlungen?
Angebote, die Menschen von ihrer Homosexualität oder ihrer selbstempfundenen geschlechtlichen...