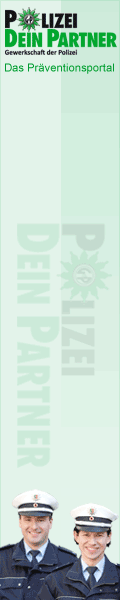Wenn Mütter ihre Kinder töten
– eine Untersuchung von -Neonatizid und Infantizid unter besonderer Berücksichtigung sozialbiographischer Bezüge: Aktuelle Befunde aus einem Forschungsprojekt (2010 – Jan. 2014)
Dr. Bettina Goetze, Referentin im Ministerium für Justiz und Gleichstellung Sachsen-Anhalt1
für M.G. …
…der die Fertigstellung des Beitrages aufgrund eines tragischen Schicksalsschlags nicht mehr erleben durfte…
Tötungsdelikte an sich erscheinen häufig irrational. Schwerlich vorstellbar sind insbesondere Verbrechen, bei denen Frauen töten. Wenn Mütter ihre Kinder in einem aufgeklärten Zeitalter töten, erscheint die Situation nahezu paradox. Unzweifelhaft wird die Mehrheit der Tötungsdelikte von männlichen Tätern verübt. Aus eben diesem Grunde konzentrierte sich die Forschungslandschaft im Bereich der Tötungsdelinquenz jahrzehntelang vorrangig auf männliche Täter. Frauen hingegen, die durchaus auch grausame Tötungsdelikte verüben, gerieten weitgehend aus dem Blickfeld. Dies ist mitunter darauf zurückzuführen, dass ihnen traditionell eher eine Opferrolle zugeschrieben wird. Die Ausnahme bilden sicherlich historische Giftmörderinnen á la Christa Lehmann, Anna Zwanziger, Gesche Gottfried oder Maria Rohrbach, die mittels E 605, Arsen oder Thallium ihren selbstsüchtigen Bedürfnissen nachgingen. Dennoch ist es wichtig, auch die heutigen Tötungsdelikte von Frauen im Detail zu betrachten, da diese mitunter spezifische Muster aufweisen. Bei Kapitalverbrechen ist die Rollenzuschreibung somit längst nicht mehr klar.
Kindstötungsdelikte durch die eigene Mutter passieren, zumindest das Hellfeld betreffend, relativ selten auf bundesdeutscher Ebene. Es ist von ca. 30 bis 40 Fällen pro Jahr auszugehen. FachvertreterInnen vermuten allerdings eine recht hohe Dunkelziffer aus. Ob dieses Dunkelfeld tatsächlich so hoch ist, kann nicht beurteilt werden. Zwar ist das Dunkelfeld im Gegensatz zur registrierten Kriminalität immer höher zu bewerten, man muss jedoch hierbei auch die Frage stellen, welche Indikatoren dieser Aussage zu Grunde liegen? Knochenfunde, die auf kindliche Opfer hindeuten, werden sehr selten im Bundesgebiet gefunden. Da sich Mütter bei der Beseitigung des kindlichen Leichnams nicht sonderlich viel Mühe geben, ist ein zeitnaher Fund des Opfers zudem sehr wahrscheinlich, es sei denn, die „Aufbewahrung“ erfolgt im häuslichen Bereich der Mutter. Auf das Spielfeld der Argumentation sind jedoch unentdeckte Taten in Folge von MSBP2 oder SID3 im Kontext eines getarnten Infantizid zu führen.4
Aussagekräftige internationale Forschungsergebnisse liegen insbesondere aus Finnland und den USA vor. In Deutschland hat das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen gehaltvolle Studien auf dem Forschungsfeld hervorgebracht. Gleichwohl handelt es sich um ein Forschungsgebiet, das längst noch nicht als abgeschlossen betrachtet werden kann.
Ab 2005 setzte in Deutschland eine öffentliche Diskussion um die Ursachen des Phänomens ein – jener Zeitpunkt, als die Außenwelt erfuhr, dass im brandenburgischen Brieskow-Finkenheerd Sabine H. wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags an ihren neun Kindern beschuldigt wird. Aus sozialbiographischer Untersuchungsperspektive ist dies übrigens der Fall, der eine der interessantesten Konstellation aufweist. Die Konsequenz war damals eine ganze Bandbreite von Spekulationen, Hypothesen und wenig überzeugenden Darstellungen innerhalb der medialen Öffentlichkeit, die u.a. suggerieren, im Osten des Landes würden vermehrt Kinder getötet. Die scheinbar so naheliegende und diplomatische Auflösung der Irritation um die Ost-West-Verteilung des Straftatbestands könnte ein dezidierter Blick auf die Statistik liefern. Gegenwärtig existieren in Deutschland allerdings keine offiziellen Zahlen zum Neonatizid und der Kindesaussetzung. Dies war jedoch bis 1997 noch der Fall, ehe dann der § 217 StGB abgeschafft wurde. Im Übrigen sah dieser – nach wie vor häufig diskutierte und ebenso kritisierte – Privilegierungsparagraph eine deutlich mildere Strafe für Frauen vor, die ihr uneheliches Kind getötet haben. Noch immer ist der Wegfall dieser gesetzlichen Regelung höchst umstritten. Und dennoch: Es existiert heutzutage kein einziger zwingender Grund, einer derartigen Differenzierung im Strafrechtssystem nachzutrauern. Im Umkehrschluss lässt sich diese Betrachtungsweise als Diskriminierung von verheirateten Frauen charakterisieren. Ignoriert wurde hierbei das Benachteiligungsverbot, das untersagt, Menschen wegen bestimmter Merkmale ungleich zu behandeln. Unabhängig davon existiert im gesamten Untersuchungsgut kein einziger Hinweis darauf, dass die Existenz eines unehelichen Kindes das Motiv der Tötung bildete. Überflüssig ist die einstige Besserstellung ohnehin, da § 213 StGB und § 21 StGB bereits Möglichkeiten der Strafminderung bieten. Tatsächlich zeigt auch die gängige gerichtliche Sanktionspraxis, dass die Täterinnen aufgrund diagnostizierter psychischer Labilität gelegentlich sogar freigesprochen werden.
„Ich fühl mich noch nicht als Mutter. In drei oder vier Jahren hätte ja man mal drüber reden können…“
 Foto: Die Kriminalpolizei
Foto: Die Kriminalpolizei
Zielstellung und Methode:
Der Fokus dieses Beitrages liegt weder auf einer quantifizierenden Betrachtungsweise, noch auf Strafzumessungsgründen. Thematisiert werden vielmehr aktuelle Kernbefunde einer Dissertation, die am Fachbereich der Humanwissenschaften der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg angesiedelt war. Die Zielstellung der Untersuchung beinhaltet eine Rekonstruktion der biografischen Verläufe jener Frauen, die einen Neonatizid oder Infantizid verübten bzw. ihr Kind aktiv oder passiv aussetzten. „Für qualitativ-empirische Biografieanalysen ist die Perspektive ‚Lebenslauf’ insofern bedeutsam, als sie Aspekte der gesellschaftlichen Vorstrukturierung und kulturellen Präskription individueller Biografien betrifft.“5
Beginnend ab dem frühen Kindesalter wurde der Lebensverlauf von Täterinnen unter Rückgriff auf Fallstudien untersucht, um Aufschluss über prägende Sozialisationsbedingungen zu erlangen. Vor diesem Hintergrund wurden Eltern- und Geschwisterbeziehungen, Erziehungsstile, Peergroup-Verhalten, Berufskarrieren, Partnerschaft und Sexualbeziehungen, Handlungsumwelten, kritische Lebensereignisse sowie Lebensorientierungen und Einstellungen dezidiert betrachtet. Zur Anwendung kam das Verfahren der Datentriangulation, indem verschiedene Methoden und Daten kombiniert wurden. Das Ziel einer jeden Triangulation besteht darin, die unterschiedlichen Materialkontexte des Untersuchungsfeldes heranzuziehen, um in der Zusammenschau ein komplexes und vollständiges Bild zu erhalten. Im vorliegenden Fall wurden autobiographisch-narrative Interviews mit Täterinnen, Experteninterviews sowie Dokumentenanalyse verschränkt. In einigen Fällen wurden insbesondere bei jungen Täterinnen zum Zweck der Perspektivenerweiterung deren Eltern ausführlich interviewt, sofern eine Gesprächsbereitschaft vorlag.
Insgesamt wurden 7 autobiographisch-narrative Interviews geführt, 20 ExpertInnen befragt sowie 100 Dokumente verschiedener Fälle in Augenschein genommen (Vernehmungsprotokolle, Urteile, forensische Gutachten, Fallakten der JVAs etc.). Die Untersuchung fand in Sachsen-Anhalt, Sachsen, Berlin und Brandenburg statt. Würde man die Frage stellen, was die große Schwierigkeit dieser Arbeit ausmachte, so ist die Antwort klar: Die Herstellung einer Kooperationsbasis, sowohl die Täterinnen als auch die Angehörigen, betreffend. Dabei waren im Hinblick auf die Auskunftswilligen zwei Phänomene schnell erkennbar: Anfänglich zögerliche Kommunikationsbereitschaft legte sich nach den ersten Minuten, so dass nach ca. fünf Stunden durchschnittlicher Befragungszeit das Ende des Gespräches sogar häufig bedauert wurde. Des Weiteren zeigten sich die Väter der Täterinnen stets auskunftsfreudiger, während die Mütter dem Geschehen skeptisch gegenüberstanden und lediglich spärliche Informationsgehalte preisgaben.
Service
Aktivitäten
Aktuelle Ausgabe

Mit ihrem aktuellen und vielfältigen Themenspektrum, einer Mischung aus Theorie und Praxis und einem Team von renommierten Autorinnen und Autoren hat „Die Kriminalpolizei“ sich in den vergangenen Jahren einen ausgezeichneten Ruf erworben.
Erklärung einschlägiger Präventions-Begriffe
Meist gelesene Artikel
RSS Feed PolizeiDeinPartner.de
PolizeideinPartner.de - Newsfeed
-
Wie Betrüger Künstliche Intelligenz nutzen
Wenn uns jemand darauf aufmerksam macht, dass eine Überweisung getätigt wurde, die wir nicht...
-
Datenklau durch Scraping
Es gehört mittlerweile schon zur Normalität des Internets, dass immer wieder Fälle von...
-
Mehr Falschgeld in Deutschland
Ein Dutzend Vermögende sind 2023 in Deutschland beim Barverkauf ihrer teuren Uhren oder Autos von...
-
Verbraucherschutz-Training für Jugendliche
Gefahren durch Fake-Shops und Cyberkriminelle
-
Sommerreifen mit Bedacht wechseln!
Kälteeinbrüche auch im April möglich
-
Mehr Informationssicherheit für Feuerwehren
BSI und Feuerwehrverband starten gemeinsame Initiative
-
Statistik: Zahl der Verkehrstoten ist 2023 gestiegen
TÜV und DVR fordern Konsequenzen