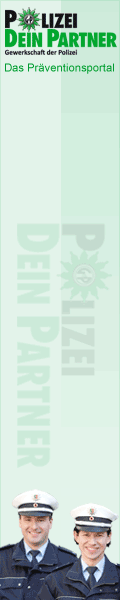Polizisten in der Krise
Polizisten in der Krise
Berufliche Belastungen mit Hilfe von Krisenintervention und Supervision verarbeiten lernen
Jeder Polizist kennt sie: Unverarbeitete Schreckenserlebnisse, die große Stress- und Belastungsreaktionen auslösen. Ob beim Einsatz mit der Schusswaffe, körperlichen Angriffen oder bei Einsätzen mit Sterbenden und Toten – Polizeibeamte stehen immer wieder neuen Herausforderungen gegenüber. Viele der belastenden Situationen können tiefe Spuren in der Erinnerung hinterlassen. Mögliche Folgen der seelischen Last sind u.a. Angststörungen, Überforderungsgefühle, Depressionen bis hin zu Suchterkrankungen. Damit es erst gar nicht soweit kommt, sprechen wir in dieser Ausgabe über die berufsspezifischen Belastungen von Polizeibeamten, sowie den Möglichkeiten belastende Einsätze zu verarbeiten. Ein besonderes Augenmerk haben wir dabei auf die psychosomatischen Therapiemöglichkeiten und ihre Erfolgschancen gelegt.
Situation von Polizeibeamten
Jeder von uns weiß: Es gibt Erfahrungen, welche so tief in das Gefühl einschneiden, dass selbst wir Polizisten sie mit erlernten, schützenden Strategien nicht mehr allein bewältigen können. In unserem Berufsalltag gefährden wir nicht selten unser eigenes Leben, werden konfrontiert mit den Abgründen der Gesellschaft und müssen zudem persönliche Beschimpfungen hinnehmen.
Doch anstatt die extremen Situationen zu verarbeiten, sie in Gesprächen zu reflektieren, ist es in unserem Beruf noch immer Gang und Gebe, diese Ereignisse zu verdrängen. Irgendwie passt es nicht in das vorgegebene Rollenbild. Wir sehen uns auf der einen Seite als Vertreter der Staatsautorität, als starkes Vorbild, andererseits haben wir auch ganz normale Ängste, Gefühle und Überforderungsbereiche. Doch wer gibt eine Überforderung gerne zu? Die Scham ist oft groß, wenn wir erkennen, dass wir das von der Öffentlichkeit geprägte „Heldenbild“ nicht in jeder Lage erfüllen können. Aber: Wir sollten nicht vergessen, dass unverarbeitete seelische Prozesse schwere gesundheitliche und soziale Folgen haben können. Unterstützung bei der Verarbeitung gibt es, auch wenn hier noch weiter viel getan werden muss. Zunächst einmal ist auf die vorhandenen Angebote zu verweisen, wie Präventionsseminare oder die Beratung durch Polizeipsychologen. Wir sollten die Angebote annehmen und uns öffnen. Immer mit dem Wissen – alle, auch Polizisten haben Gesprächsbedarf nach belastenden Einsätzen.
Reaktionen auf besondere Belastungen
Kritische Einsätze können Stress- und Belastungsreaktionen auslösen, diese sollten nicht verdrängt werden. Vorübergehendes Wegschieben entlastet zwar für den Moment, kann aber auf Dauer zu chronischen Gefühlen von Frustration oder auch Aggression führen. Es kann sich eine Abhängigkeit entwickeln.
Nicht selten haben die betroffenen Polizisten das Gefühl nicht genug unternommen zu haben. Dieses Gefühl kombiniert mit (teils auch unbewussten) Schuldgefühlen, beschreiben sie dann mit den Worten „Ich sah alles wie in Zeitlupe“ oder „Ich hatte das Gefühl, ich stehe neben mir“. Im weiteren Dienst fühlen sie sich dann zunehmend überfordert, den Abstand zum Ereignis und Erholung finden sie allein nicht mehr. Im (allerdings seltenen) Extremfall kann das zu einer so genannten „Posttraumatischen Belastungsstörung“ (PTSB) oder zu einem Burn-out-Syndrom führen. Erkennungsmerkmale für ein PTSB sind u. a. Albträume, eine Vermeidung von Aktivitäten die an das traumatische Ereignis erinnern, Gereiztheit und Schlaflosigkeit. Eines der wichtigsten Symptome ist die so genannte „Intrusion“, auch „Flash back“ genannt: Der oder die Betroffene werden durch ein Wort, ein Geräusch oder einen Geruch derart an das traumatische Erlebnis erinnert, dass plötzlich alles wieder da ist: Die körperliche und die seelische Reaktion wiederholen sich, als sei das Geschehen erneut gegenwärtig. Das kann sehr qualvoll werden. Wichtig zu wissen ist, dass diese Symptome oft erst nach Wochen oder Monaten auftreten. Unbehandelt ist die zusätzliche Entwicklung einer Suchterkrankung, einer Depression oder auch einer Angsterkrankung möglich.
Weitaus häufiger als Wut und Aggressivität ist allerdings eine gegensätzliche Reaktion und zwar der emotionale Rückzug. Auch hier die Gefahr: Mit dem Rückzug können sich Depressionen oder Angststörungen entwickeln. Anstatt sich aktiv mit dem Erlebten auseinanderzusetzen, zu reflektieren was ist passiert, wie habe ich mich verhalten und wie verhalte ich mich in Zukunft, wenn ich wieder in eine kritische Situation komme, vermeiden Beamte ein wiederholtes Durchleben der vergangenen Geschehnisse. Gründe hierfür sind neben dem ausgeprägten Image der starken Persönlichkeit auch Ängste vor disziplinarischen Maßnahmen. Nicht selten greifen Betroffene zu Alkohol oder Drogen, um die Angst zu verdrängen oder das Gefühl der Überforderung wegzuspülen. Doch mit dem Suchtmittel werden die Sorgen nicht kleiner, ganz im Gegenteil.
Was kann jeder Einzelne tun?
Prävention und Information sind die ersten Schritte um psychischen Erkrankungen erst gar nicht eine Chance zu geben. Hierzu gehören unter anderem die Krisenintervention und Seminare zur Stressbewältigung. In der fundierten Krisenintervention werden Polizeibeamte auf kritische Situationen vorbereitet, damit im Fall der Fälle der jeweilige Kollege die Situation einordnen und begreifen kann. Ziel der Lehrgänge ist es, Wissen über mögliche Reaktionen in schwierigen Situationen zu vermitteln sowie damit verbunden eine physische Stärke bei den Teilnehmern aufzubauen. Besuchen Sie regelmäßig die angebotenen Seminare und Informationsveranstaltungen zur Konflikt- und Stressbewältigung.
Darüber hinaus empfehlen Ärzte und Psychologen die Einführung einer ständigen psychologischen Betreuung von Polizisten, etwa durch die Supervision. Diese Möglichkeit bietet der Sozialdienst der Polizei. Dort stehen speziell geschulte Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung, die den Dienst aus eigener Er-
fahrung gut kennen und sich das erforderliche zusätzliche Know-how angeeignet haben. Sie helfen Ihnen, Geschehnisse und Probleme aus der Distanz und frei vom unmittelbaren Handlungsdruck anzuschauen. Diese Art der Unterstützung wird von den Experten als sehr sinnvoll angesehen, da sie die Fähigkeit in der Auseinandersetzung mit der eigenen Person, der Rolle im Beruf und den Kollegen lehren, immer mit dem Ziel das berufliche Handeln zu professionalisieren.
Beispielsweise werden exemplarisch Konflikte aus dem Berufsalltag thematisiert und in den Bezug zur „Berufsrolle“ gestellt. Das heißt, Polizisten lernen ihre Gefühle in bestimmten Situationen selbst zu sehen, im zweiten Schritt zu kontrollieren und daraus folgend eine bewusste, zielgerichtete Entscheidung zu treffen. Sie handeln also aufgrund von Erkennen und Verstehen.
Hilfe nach einem Extremereignis
Jeder, der eine extrem schwierige Situation erlebt benötigt nach dem ersten Schockzustand Hilfe. In erster Linie geht es um die emotionale Unterstützung. Kollegen, Familie und Freunde spielen hierbei eine große Rolle. Die Betroffenen sollten die Möglichkeit zu Gesprächen nutzen, für eine Klärung dessen, was geschehen ist. Angehörige und Freunde sollten auf die Beamten zugehen, fragen was sie belastet und wie man helfen kann. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit sich an den sozialmedizinischen Dienst zu wenden oder an die Polizeipsychologen. Hier stehen ihnen folgende Hilfsangebote zur Verfügung:
- Vertrauliche Gespräche zur Entlastung und Orientierungshilfe
- Beratungen von Familienangehörigen
- Klärung von Konflikten am Arbeitsplatz
- polizeiinterne Selbsthilfegruppen
- Vorbereitung von Therapiemaßnahmen und Klärung von Kostenfragen
Hilfe im Notfall – psychosomatische Therapie Sehen Betroffene keine Möglichkeit, die bedrückenden Ereignisse mit Kollegen, Freunden oder Polizeipsychologen zu besprechen und gelingt es ihnen nicht, die entstandenen Probleme ausreichend zu verarbeiten, dann sollten sie sich nicht scheuen einen Arzt aufzusuchen.
Es gibt Hilfsangebote von Außen. Ein Beispiel dafür ist das Angebot der Oberbergkliniken, wo Polizisten Lehrer und Ärzte eine Behandlung von Angst- und Abhängigkeitserkrankungen, dem Burn-out Syndrom sowie Depressionen erfahren können.
Inhalte der psychosomatischen Therapie: Eine stationäre Therapie (nach dem Oberbergmodell) dauert durchschnittlich sechs bis acht Wochen und integriert die körperlichen und seelischen Aspekte. Das
Ziel ist, bei den Patienten nicht nur eine körperliche Stabilität herzustellen, sondern sie sollen durch das Wahrnehmen ihrer aktuellen Lebensgewohnheiten Einsicht in den persönlichen Zustand erlangen und anschließend lernen auch mit schwierigen Situationen in Zukunft besser umzugehen.
In der ersten Phase der Behandlung erfolgt demnach eine Analyse der bestehenden Situation. Betroffene erhalten die Möglichkeit, sich mit ihrem derzeitigen Befinden und den langfristigen Veränderungen, die durch den erlebten Schreckensvorfall entstanden sind auseinander zu setzen. Gesprochen wird über den inneren Frust, die Aggressionen oder auch die tief im Inneren fest sitzende Angst.
Dabei geht es auch darum festzustellen, was als Problem wahrgenommen wird und was die eigentliche Sorge ist. Auch die Frage, wie es um zwischenmenschliche Probleme steht. Was hat meine Lage möglicherweise mit äußeren Umständen zu tun? Wie sieht der Umgang mit meinem Partner oder das Verhältnis zu meinen Arbeitskollegen aus? Hinter der Klärung all dieser Fragen steht: Nur wenn ich mir meiner Situation selbst bewusst bin, kann ich Lebensgewohnheiten aktiv ändern.
In Phase zwei werden Lösungsstrategien erarbeitet, die gesünder sind als der bisherige Lebensstil – d.h. Patienten erlernen situationsgerechte Verhaltensweisen, die dazu beitragen auf Geschehnisse im Alltag angemessen zu reagieren. Dazu gehört unbedingt auch das „Offene Gespräch“. Nur so kann es gelingen, den wiederkehrenden Belastungen im Beruf eines Polizisten Stand zu halten.
Im letzten Schritt der Therapie werden die neu erlernten Verhaltensweisen geübt, bis die Patienten sie verinnerlicht haben. So können die Beamten in Zukunft ihren Dienst gestärkt versehen.
Der Fall der Suchterkrankung
In dem Fall, wo neben der seelischen Belastung eine Alkohol- oder Medikamentenabhängigkeit vorliegt, steht an erster Stelle der Entzug der Droge. Die Betroffenen müssen lernen die Krankheit zu akzeptieren, den Willen entwickeln, sich von der Sucht zu lösen und auch zukünftig von der Droge fern zu bleiben. Zur Hilfe kommt die Klärung der Frage, wozu diente der Suchtstoff mir eigentlich? Ist die Erkenntnis gewonnen, dass Drogen nicht helfen geht es darum Alternativen zu erarbeiten. So lernen Patienten während der Entwöhnungsphase verschiedene Entspannungstechniken, wie progressive Muskelentspannung oder autogenes Training kennen und werden wieder an den Sport herangeführt. Im Anschluss an eine erfolgreiche Therapie wird die ambulante Nachsorge geplant und organisiert.
Unterstützt wird diese durch ein Netz aus Korrespondenztherapeuten und zahlreiche Selbsthilfegruppen in ganz Deutschland.
Ein messbarer Erfolg für die positive Verarbeitung von Schreckenserlebnissen liegt in den so genannten Copingstrategien, oder auch bekannt als Bewältigungsstrategien. Coping meint, dass ein bestimmtes Verhalten angewendet wird, um Anforderungen, die einen Menschen stark beanspruchen zu bewältigen. Sind diese einmal erlernt, können Patienten auf zukünftige belastende Situationen angemessen reagieren und sich offen damit auseinandersetzen. Copingsstrategien beugen Weinkrämpfen, Wutausbrüchen oder Zerstörungswut vor.
Ein Aufruf der Ärzte, die sich der Behandlung von Polizisten gewidmet haben bleibt zum Schluss: „Öffnen Sie sich und sprechen Sie über Probleme, Sie müssen nicht alleine damit kämpfen, jeder der eine Krise erfährt benötigt Hilfe, egal ob Polizist, Arzt oder U-Bahnfahrer.“ Aus einer falschen Scham kann sich eine schwere Krankheit entwickeln. Diese ist aber zu verhindern.
Von Anja Smetanin,
ehemalige Pressesprecherin/Redakteurin der psychosomatischen Oberbergkliniken
Für weitere Informationen und Interviewwünsche:
Leitung Marketing Kommunikation
Heike Weber
Oberberg Kliniken Holding GmbH
Charlottenstraße 60 / Gendarmenmarkt
10117 Berlin
Tel. 030 - 31 98 504-05
Fax 030 - 31 98 504-11
E-Mail: [email protected][email protected]
Service
Aktivitäten
Aktuelle Ausgabe

Mit ihrem aktuellen und vielfältigen Themenspektrum, einer Mischung aus Theorie und Praxis und einem Team von renommierten Autorinnen und Autoren hat „Die Kriminalpolizei“ sich in den vergangenen Jahren einen ausgezeichneten Ruf erworben.
Erklärung einschlägiger Präventions-Begriffe
Meist gelesene Artikel
RSS Feed PolizeiDeinPartner.de
PolizeideinPartner.de - Newsfeed
-
Wie Betrüger Künstliche Intelligenz nutzen
Wenn uns jemand darauf aufmerksam macht, dass eine Überweisung getätigt wurde, die wir nicht...
-
Datenklau durch Scraping
Es gehört mittlerweile schon zur Normalität des Internets, dass immer wieder Fälle von...
-
Mehr Falschgeld in Deutschland
Ein Dutzend Vermögende sind 2023 in Deutschland beim Barverkauf ihrer teuren Uhren oder Autos von...
-
Verbraucherschutz-Training für Jugendliche
Gefahren durch Fake-Shops und Cyberkriminelle
-
Sommerreifen mit Bedacht wechseln!
Kälteeinbrüche auch im April möglich
-
Mehr Informationssicherheit für Feuerwehren
BSI und Feuerwehrverband starten gemeinsame Initiative
-
Statistik: Zahl der Verkehrstoten ist 2023 gestiegen
TÜV und DVR fordern Konsequenzen