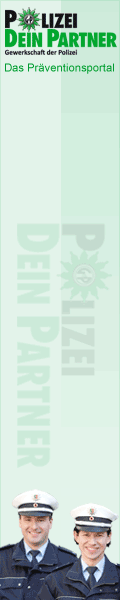Was wird gemessen, wenn „Islamfeindlichkeit“ gemessen wird?
Journalisten in sensationsorientierten Medien neigen in der Tat nicht selten zu skandalisierenden, polemisierenden und/oder kulturalistischen Debattenbeiträgen. Sie müssten sich auch dem Vorwurf der Homogenisierung vielschichtiger Gruppen von außen stellen. Und man kann auch behaupten, dass stereotypisierende Berichterstattung Vorurteile und Ressentiments fördert (vgl. Schiffer 2005: 24). Zu fragen ist in diesem Zusammenhang, ob die mehr oder weniger einseitige, undifferenzierte Berichterstattung und Inszenierung der politischen Mythen nicht vielleicht einen breiteren Themenhaushalt betrifft. Eine Domäne der Berichterstattung über „den“ Islam und „die“ Muslime ist sie jedenfalls nicht. Dass die internationale Berichterstattung über den islamisch geprägten Raum vor dem Hintergrund der Kriege, der Terroranschläge oder der Unterdrückung und Folter stattfindet, wird eine größere Bedeutung für die wachsende Islamablehnung haben als vermeintlich ausbleibende Aufklärung durch den Journalismus. Wohlgemerkt würde die gewünschte Differenzierung bei den Themen Freiheit und Menschenrechte oft einer gefährlichen Relativierung nahekommen. Zugleich wurde seit Ende der 1990er Jahre in keiner anderen Religion der Name Gottes so oft gezielt medienwirksam missbraucht wie im (radikalen) Islam. Obwohl die meisten Anschläge in der EU durch Rechts- und Linksextremisten verübt werden1, scheint jeder Anschlag(splan) in Europa die Gefährlichkeit „des“ Islam zu bestätigen – nicht zuletzt, weil die sich auf den Koran berufenden Islamisten bzw. Dschihadisten sich in einem erklärten Krieg gegen „den Westen“ wähnen.
Der eigentliche Kern der Islamdebatte in Deutschland ist allerdings ein anderer und betrifft vor allem die Vereinbarkeit des Säkularismus als Norm- und Wertvorstellung mit dem islamischen Glauben, in dem es bekanntlich keine Kaiserformel2 gibt. Während säkulare Verfassungsgrundsätze eine respektvolle Nichtidentifikation als Wertneutralität, welche die Gleichstellung und den Schutz jeder Minderheit gewährleistet, zum Maßstab erheben, enthält das islamische Ordnungsmodell grundsätzlich nur eine sehr spezifische Schutzpflicht für Minderheiten (Schutzbefohlene per Schutzvertrag), welche keine Gleichstellung mit Muslimen vorsieht.
Vor diesem Hintergrund formulierten die Islamophobie-Forscher Leibold und Kühnel das Dilemma der Norm- und Wertkonflikte wie folgt: „Vor die Entscheidung gestellt, würden die meisten gläubigen Muslime wohl das religiöse dem säkularen Prinzip überordnen. Selbst die flexiblen Alltagsregelungen stellen faktisch das Primat des Religiösen unter Beweis, da die Toleranz mit Rückbezug auf die Scharia begründet wird“ (Leibold & Kühnel 2008: 98). Im Sinne des Modells der Eigengruppenprojektion haben wir es mit zwei Makro-Gruppen zu tun, die auf zwei unterschiedliche übergeordnete soziale Kategorien – „menschliche Zivilisation“ oder „Religion“ – zurückgreifen und ihre eigenen Vorstellungen von diesen Kategorien („universelle Menschenrechte“ – der Islam als die „vollkommene“ Religion) auf sie projizieren, um den Gruppenvergleich zu gestalten. So gewährleistet das Ergebnis eines solchen Vergleichs die Überlegenheit der jeweiligen Gruppe. Mit Blick auf die Menschenrechte erscheint „der“ Westen im Vergleich zum „Islam“ als überlegener Sieger, während Angehörige des Islam sich frei nach dem Koran als „die beste Gemeinde“ sehen und islambezogene Überlegenheitsgefühle entwickeln: „Aus einer sozialpsychologischen Perspektive haben wir es, was die Beziehungen zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen betrifft, zunächst einmal mit einem ‚Zusammenprall‘ von Vorurteilen (zweier sozialer Gemeinschaften) und Mythen (über den ‚Islam‘ und ‚den Westen‘) zu tun“ (Frindte 2013: 114, 120; vgl. Bobzin 2010; Jonker 2010b: 72).
Empirische Probleme des Konstrukts
Die kritische Auseinandersetzung mit den empirischen Studien3 führt zu dem Schluss, dass die Frage nach ihrem Messgegenstand und den Interpretationen sowie den theoretischen Implikationen berechtigt erscheint. So verwenden einerseits einige Umfragen mehr oder weniger harte Items zur Messung ähnlicher Konstrukte. Andererseits werden gleiche Items zur Erhebung mehr oder weniger harter Einstellungen eingesetzt. Als Ursache für diese Divergenzen kann die terminologische Unklarheit bzw. mangelhafte Spezifikation der jeweiligen Konstrukte gelten, die es ermöglicht, solch unterschiedliche Phänomene wie Ablehnung, diffuse Angst respektive Bedrohungsgefühle, Abwertung und Feindseligkeit wenig differenzierend mal als Phobie, mal als Feindlichkeit zu apostrophieren. Es liegen zugleich nur wenige Versuche vor, ein differenzierteres Bild der facettenreichen Ablehnungskonstruktionen und der Befragten-Cluster zu zeichnen (vgl. Leibold & Kühnel 2006; Foroutan 2014).
Ein weiteres Dilemma hängt mit der semantischen Dimension der verwendeten Aussagen zusammen. So zeigte die konfirmatorische Faktorenanalyse, dass der Bedeutungsinhalt des einige Zeit eingesetzten Items „Der Islam hat eine bewundernswerte Kultur hervorgebracht“ weniger auf Abwertung des Islam als auf die wahrgenommene kulturelle Distanz verwies (Leibold & Kühnel 2008: 113). Mit Hilfe der Aussagen „Für mich sind die verschiedenen islamischen Glaubensrichtungen kaum zu unterscheiden“ sowie „Meiner Meinung nach sind die islamischen Glaubensrichtungen sehr ähnlich“ wurden z. B. im GMF-Survey 2005 primär Wissensbestände über den Islam abgefragt, jedoch weniger homogenisierende Einstellungen gemessen (vgl. Kahlweiß & Salzborn 2012: 249). Ob „der“ Islam pauschal oder primär radikale Gruppen als Bedrohung ausgemacht werden, hängt stark von der Item-Formulierung und ihrem Homogenisierungsgrad ab. Es verwundert nur wenig, dass in der Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach (2012) 74 % der Befragten dafür plädierten, dass nur von bestimmten radikalen Gruppen eine Bedrohung ausginge. Zugleich bleibt „das Image des Islam“ mit Blick auf Menschenrechte negativ.
Service
Aktivitäten
Aktuelle Ausgabe

Mit ihrem aktuellen und vielfältigen Themenspektrum, einer Mischung aus Theorie und Praxis und einem Team von renommierten Autorinnen und Autoren hat „Die Kriminalpolizei“ sich in den vergangenen Jahren einen ausgezeichneten Ruf erworben.
Erklärung einschlägiger Präventions-Begriffe
Meist gelesene Artikel
RSS Feed PolizeiDeinPartner.de
PolizeideinPartner.de - Newsfeed
-
Wie Betrüger Künstliche Intelligenz nutzen
Wenn uns jemand darauf aufmerksam macht, dass eine Überweisung getätigt wurde, die wir nicht...
-
Datenklau durch Scraping
Es gehört mittlerweile schon zur Normalität des Internets, dass immer wieder Fälle von...
-
Mehr Falschgeld in Deutschland
Ein Dutzend Vermögende sind 2023 in Deutschland beim Barverkauf ihrer teuren Uhren oder Autos von...
-
Verbraucherschutz-Training für Jugendliche
Gefahren durch Fake-Shops und Cyberkriminelle
-
Sommerreifen mit Bedacht wechseln!
Kälteeinbrüche auch im April möglich
-
Mehr Informationssicherheit für Feuerwehren
BSI und Feuerwehrverband starten gemeinsame Initiative
-
Statistik: Zahl der Verkehrstoten ist 2023 gestiegen
TÜV und DVR fordern Konsequenzen